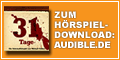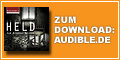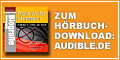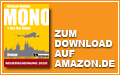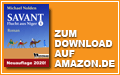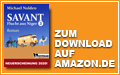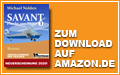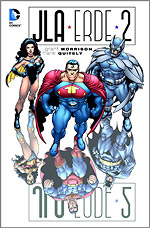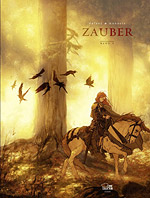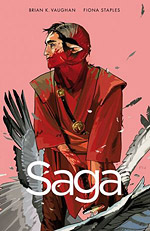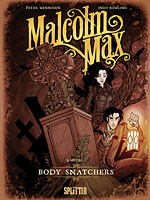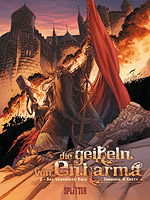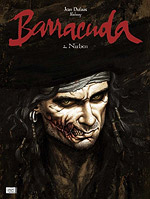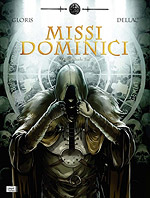Sonntag, 14. September 2014
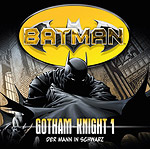 Die Gangster sind nicht dumm. Der Mann in Schwarz hat sich technische Spielzeuge zugelegt, die auch Batman gefährlich werden können. Aber warum das Risiko unnötig in die Höhe treiben? Wenn man auch per Jetpack frühzeitig entkommen kann? Aber die Farbe Schwarz? Warum? Die Antwort sollte Batman nicht erstaunen und doch wundert sie ihn ein wenig. Viel Zeit kann er trotzdem nicht auf die Analyse von feindlichen Beweggründen verwenden. In Gotham City ist der Teufel los, im übertragenen Sinne zwar, aber Gegner wie Scarecrow geben sich die größte Mühe dem Original so nahe wie möglich zu kommen.
Die Gangster sind nicht dumm. Der Mann in Schwarz hat sich technische Spielzeuge zugelegt, die auch Batman gefährlich werden können. Aber warum das Risiko unnötig in die Höhe treiben? Wenn man auch per Jetpack frühzeitig entkommen kann? Aber die Farbe Schwarz? Warum? Die Antwort sollte Batman nicht erstaunen und doch wundert sie ihn ein wenig. Viel Zeit kann er trotzdem nicht auf die Analyse von feindlichen Beweggründen verwenden. In Gotham City ist der Teufel los, im übertragenen Sinne zwar, aber Gegner wie Scarecrow geben sich die größte Mühe dem Original so nahe wie möglich zu kommen.
Der Mann in Schwarz: Ein Wiederhören mit zwei Stimmen, die maßgeblich am Erfolg einer Serie hierzulande beteiligt waren. Die Serie hieß Miami Vice, die deutschen Synchronstimmen von Don Johnson und Philip Michael Thomas hießen Reent Reins und Lutz Mackensy. Beide markante Stimmen waren in der Vergangenheit immer wieder in Hörspielen zu hören, aber selten vereint. Reent Reins übernimmt hier die Rolle des Commissioner James Gordon, des direkten Kontakts zu Batman und tatsächlich hat die Stimme eine dunklere Färbung mit den Jahren bekommen, eine Klangfarbe, die zur väterlichen Ausfüllung des Charakters von Commissioner Gordon passt. Lutz Mackensy hingegen darf mit seiner scheinbar ewig jugendlichen Stimme den Wahnsinn eines gefährlichen Kriminellen erschallen lassen. Hier klingen Können und Spaß an der Arbeit durch.
Die erste Folge der Trilogie über den Gotham Knight etabliert diese düstere Megastadt als kriminelles Babel, aber auch als Touristenmagnet. Ausgerechnet auf einer Aussichtsplattform, die in Anspielung auf einen der bekanntesten Batman-Zeichner, Jim Aparo auf dem Aparo-Tower gelegen ist, darf der dunkle Ritter in beeindruckendem Hörkino erstmalig so richtig zeigen, was er drauf hat. Sascha Rotermund orientiert sich, wie die gesamte Trilogie, an der filmischen Neuinterpretation (mit Christian Bale) des Mitternachtsdetektivs. Rauchig gesprochen als maskierter Rächer, locker als Privatperson und Playboy Bruce Wayne. Letzterem hört man sehr gerne im Zusammenspiel mit Charakteren wie Commissioner Gordon oder dem erfindungsreichen Lucius Fox (gesprochen von Wolf Frass) zu.
Krieg: Der heimliche Held des Batman-Universums, jedenfalls in früheren Zeiten, Alfred Pennyworth, agiert hier ähnlich wie in der Batman-Trilogie mit Christian Bale. Gesprochen von Jürgen Thormann, der in den Filmen auch Michael Caine in der Rolle des Butlers synchronisiert, bekommt die Figur stets etwas sehr Vornehmes, auch Unnahbares sowie eine sehr professionelle Note. Erfrischend in dieser Episode ein ganz normales Bandenkrieg, dem Batman beikommen muss, ohne dass sein technisches Spielzeug noch seine Erscheinung besonders viel Eindruck hinterlässt.
Die beiden Polizisten Montoya und Allen bilden ein schönes Gegengewicht zur Arbeit des dunklen Ritters. Sie bieten einen großen Teil der Stimme des Menschen auf den Straßen Gothams, jene, die meist nur aus der Ferne einen Blick auf Batman werfen. Oder wie sie auf einen Schattenriss in der Türscheibe zu Commissioner Gordons Büro.
Monster: Wer tötet die Menschen nicht nur, sondern frisst sie zugleich auf? Batmans Suche nach diesem ungewöhnlichen Killer wird gruseliger, anstrengender. Nach der Jagd auf die normalsterbliche Unterwelt Gothams ist dieser Feind nur schwer auszumachen. Er hält sich im Dunkel und will nicht gejagt werden. Batman muss an Scarecrow vorbei, der nicht nur dieses seltsame Wesen geschaffen, viel schlimmer noch, eine große Schar Anhänger beeinflusst hat, gegen die sich Batman auch noch zur Wehr setzen muss.
Wurde das berühmt berüchtigte Arkham Asylum bisher hauptsächlich erwähnt (und nur kurz besucht), werden die Folgen jetzt offen sichtbar. Während Batman diese modern geschaffenen Dämonen verfolgt, stellt er sich auch seinen inneren Feinden, düsteren Erinnerungen, als er nach Wegen der Kontrolle über seine Ängste suchte. Die dritte Episode von Gotham Knight bietet eine spannende Doppelsicht auf den dunklen Ritter, in Gegenwart und Vergangenheit. Beide sind dramatisch, in beiden muss sich ein Mann beweisen. Im ersteren Fall das andere Ich, im letzteren Fall ein noch junger Bruce Wayne persönlich.
Ein Kaleidoskop aus Gotham City: Batman wird im Kopfkino dank einer tollen Interpretation durch Sascha Rotermund lebendig. Die Besetzung ist punktgenau und nimmt, nach einer Einführung in das Comic-Universum, besonders in der zweiten und dritten Episode Fahrt auf. Egal, auf welchem Weg der Fan zu Batman gefunden hat, über die Filme oder die Comics selbst, hier wird er auf jeden Fall mit neuen, sehr guten Abenteuern fündig. 🙂
Batman, Gotham Knight 1, Der Mann in Schwarz: Bei Amazon bestellen
Batman, Gotham Knight 2, Krieg: Bei Amazon bestellen
Batman, Gotham Knight 3, Monster: Bei Amazon bestellen
Links: Jürgen Thormann in Batman
Montag, 11. August 2014
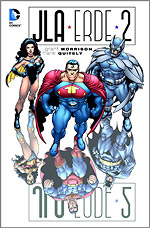 Eine andere Erde. Die Menschen leiden. Eine Verbrecherorganisation, der sich keine Macht der Welt kraftvoll genug entgegenstellen kann, regiert mit aller zur Verfügung stehenden Gewalt. Selbst ein Widerwort kann den sofortigen Tod bedeuten. In dieser verdrehten Welt gibt ein Ultraman den Ton an und ein Owlman wie auch eine Superwoman folgen ihm. Aber so widerstandslos ist ihnen die Ausbeutung der Erde dann doch nicht gegönnt. Ein hoch intelligenter Alexander Luthor sucht nach einer Möglichkeit, eine Wende herbeizuführen.
Eine andere Erde. Die Menschen leiden. Eine Verbrecherorganisation, der sich keine Macht der Welt kraftvoll genug entgegenstellen kann, regiert mit aller zur Verfügung stehenden Gewalt. Selbst ein Widerwort kann den sofortigen Tod bedeuten. In dieser verdrehten Welt gibt ein Ultraman den Ton an und ein Owlman wie auch eine Superwoman folgen ihm. Aber so widerstandslos ist ihnen die Ausbeutung der Erde dann doch nicht gegönnt. Ein hoch intelligenter Alexander Luthor sucht nach einer Möglichkeit, eine Wende herbeizuführen.
Grant Morrison (Autor) und Frank Quitely (Zeichner) sind eines jener Comic-Künstlerduos, denen es gelungen ist, Comic-Geschichten zu schaffen, die aus der Vielfalt der Erscheinungen herausragen, weil sie es wagen, einmal alles auf den Kopf zu stellen. In All Star Superman erzählten sie kurzerhand das Ende des Stählernen. In JLA – ERDE 2 kreieren sie eine Variante der JLA in Form des Crime Syndicate of America, so dass jeglicher Spaß, den sich andere Finsterlinge mit der JLA erlaubten, daneben blass aussieht.
Sie sind böse, weil sie böse sein müssen. Manche Systeme dulden eben keine Veränderung, weil sie ganz einfach nicht möglich ist. Diese Grundrichtlinie steht dem ehrgeizigen Plan von Alexander Luthor entgegen, nämlich diese Erde jener Utopie anzugleichen, die der Leser längst an der Seite von so illustren Helden wie Superman und Wonderwoman kennengelernt hat. Natürlich gibt es ein Problem. Die Grundrichtlinie sagt es aus und damit fängt das Schlamassel für beide Seiten an. Denn ganz gleich wie viel Schaden die eine Seite der andere zufügen will, sie sind letztlich wie zwei Magneten, die einander abstoßen.
Frank Quitely zeichnet penibel, mit Strichen, die auf den Punkt genau angesetzt sind, ultrafein gezogen, hier und dort etwas karikierend, immer sehr ausdrucksstark, mit grundsätzlich sehr muskulösen Gestalten, manchmal sogar drall. Kinn ist Frank Quitely an einem Gesicht sehr wichtig, die Lippen zeitweilig auch wulstig zu nennen, fast schmollend, sehr auffallend bei einem Alexander Luthor. Die Besonderheit dieser Geschichte, die Variationen der uns bekannten Helden, sind in ihrer Andersartigkeit faszinierend, weil sie gerade in den Nebenrollen extra überzogen scheinen.
Ein dem Flash an muskulöser Statur in nichts nahestehender Johnny Quick ist drogensüchtig und wirkt noch operettenhafter als es die eigentlichen, klassischen Helden ohnehin sind. Die Nebenbösewichte gestatten sich gerne ein fieses Grinsen und könnten auf ihre Art auch in eine Reihe wie The Boys passen, sind sie doch ein gutes Stück aufmüpfiger als die Originalgauner der Erde 1. Wirken diese Nebenganoven überdreht, ist das Haupttrio eher titanisch, auf beiden Seiten des Spiegels.
Kampf gegen Brainiac. Hier wird das alte Thema neu aufgelegt, gruseliger in jedem Fall. Die Auflösung ist ebenfalls anders, dank eines Ultraman auch brutaler, obwohl sich auch bei DC in den vergangenen Jahren wie bei sämtlichen Comicschmieden viel in dieser Hinsicht verändert hat.
In der Tat ein moderner Klassiker im Bereich der Superheldencomics. Gut gegen Böse, spiegelbildlich, machtlos gegeneinander. Toll erzählt von Grant Morrison, in perfekt eigenem Stil gezeichnet von Frank Quitely, von dem man leider viel zu wenig hierzulande sieht. Für JLA-Fans unverzichtbar. 🙂
JLA, ERDE 2: Bei Amazon bestellen
Mittwoch, 19. März 2014
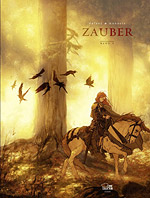 In der Hölle hat ein Teufelchen die Macht ergriffen und denkt gar nicht daran, diese Macht wieder abzugeben. Der wahre Herrscher Maldoror indes sucht einen Weg zur Rückkehr in die Unterwelt. Ohne einen Funken der früheren Stärke gestaltet sich dieses Ansinnen als äußerst schwierig. Da muss die List helfen. Mit etwas Nachdruck vielleicht. Blanche will sich, da sie und ihre Getreuen hoffnungslos unterlegen sind, mit anderen Mitteln einen Aufschub zur endgültigen Machtergreifung ihres Bruders beschaffen. Ein Trick hilft ihr dabei. Die Kämpfe und Nachforschungen der beiden so unterschiedlichen Geliebten sind langwierig, gefahrvoll und führen zu unerwarteten Veränderungen.
In der Hölle hat ein Teufelchen die Macht ergriffen und denkt gar nicht daran, diese Macht wieder abzugeben. Der wahre Herrscher Maldoror indes sucht einen Weg zur Rückkehr in die Unterwelt. Ohne einen Funken der früheren Stärke gestaltet sich dieses Ansinnen als äußerst schwierig. Da muss die List helfen. Mit etwas Nachdruck vielleicht. Blanche will sich, da sie und ihre Getreuen hoffnungslos unterlegen sind, mit anderen Mitteln einen Aufschub zur endgültigen Machtergreifung ihres Bruders beschaffen. Ein Trick hilft ihr dabei. Die Kämpfe und Nachforschungen der beiden so unterschiedlichen Geliebten sind langwierig, gefahrvoll und führen zu unerwarteten Veränderungen.
Jean Dufaux, als Szenarist im Bereich Comic ein Autor mit einer breit gestreuten Themenvielfalt vertreten, erobert mit dieser märchenhaften Geschichte, einem gehörigen Schuss Fantasy, Träumerei, Kämpfen und Humor ein weiteres Genre für sich und findet gleichzeitig eine selten ausgefüllte Nische innerhalb fantastischer, mittelalterlich anmutender Szenarien. Mit der Darstellung der Unterwelt beschreitet er gleichfalls einen seltenen Weg. Will jemand einen atmosphärischen Vergleich, wird er ihn am ehesten filmisch in Legende von finden. Betont sei nur der atmosphärische Vergleich, ansonsten haben beide Geschichten nicht miteinander gemein.
Die optisch regelrecht filmische Umsetzung des 2. Teils ist grandios und noch schöner als im Auftaktband. Die Figuren sind eingeführt und können nun aufspielen. In einer Mischung aus Disney-Stil, etwas Strichtechnik eines Uderzo und einer ordentlichen Portion Realismus entsteht ein Potpourri aus feingliedrigen, schlanken Gestalten, grotesken Charakteren, insbesondere in der Unterwelt, realistischen Accessoires und Hintergründen entfaltet sich diese ganz besondere Welt in großzügigen Seitenaufteilungen und natürlichen Farbtönen, erdig, grünlich. Es ist eine Welt im Dämmerzustand, in der es nur selten einen blauen Himmel zu sehen gibt. Licht zeigt sich in Effekten, durch Fenster in dunkle Läden strahlend oder glitzernd durch das Laubdach eines Waldes.
Horibili, zwergenartig, optisch eine Mischung aus Obelix und Alexandre Dumas dem Älteren, entpuppt sich als Bindeglied zwischen den einzelnen Handlungssträngen. Sicherlich verfolgt jeder der beiden Haupthelden sein Ziel, sind auch die Nebenfiguren mit ihren eigenen Ideen zugange, doch ohne Horibili, der scheinbar von allen Seiten nach allen Regeln der Kunst drangsaliert wird, geriete einiges ins Stocken. Dabei ist der Einfallsreichtum wie auch das Improvisationstalent des Zwergenwüchsigen interessant, ganz besonders zu dem Zeitpunkt, als dem Herrn der Unterwelt den Weg hinab weist, obwohl ihm doch eigentlich alle Zugänge verschlossen sind.
Die Unterwelt lebt optisch von ihren Gestalten. Räumlich ist sie eher ein unaufgeräumter alter Kasten, mehr Backstage als eine Bühne des Bösen. Die neue Herrscherin hat sich den Respekt ihrer Untertanen noch nicht so recht verdient. Einzig jene, die sich durch sie einen Vorteil erhoffen, reagieren mit entsprechender kriecherischer Freundlichkeit. Die Idee, eine mächtige Figur in einen Kinderkörper zu stecken, ist nicht neu (siehe auch Pandarve in der Gestalt von Alice aus dem Wunderland in der Reihe Storm). Hier wirkt sie aber noch verletzlicher, auch verlorener auf ihrem Posten.
Ihr gegenüber sind die Kreaturen der Unterwelt, die auch der Kreativschmiede aus dem Hause Lucas entsprungen sein könnten, gefährlicher anmutend, nicht unbedingt gruseliger. Sie besitzen auch eine leicht niedliche Komponente, wie sie auch den Machern um Jim Henson eingefallen sein könnten. (siehe auch Der dunkle Kristall) Dämonen sind hier auch Komödianten, aber immer bösartig.
Genügend Fragen bleiben offen. Seiten wechseln, Charaktere wandeln sich. Das lässt Vorfreude auf die Fortsetzung entstehen. Eine schöne Erzählung mit einer ganz eigenen Linie und Optik. Jean Dufaux und Jose Luis Munuera perfektionieren mit der zweiten Folge von ZAUBER das märchenhafte Fantasy-Abenteuer als eigenständiges Genre im Comic. 🙂
ZAUBER, Band 2: Bei Amazon bestellen
Samstag, 04. Januar 2014
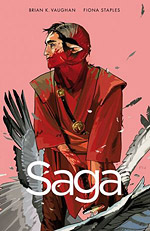 Eltern, die mit der Verbindung zum jeweiligen Partner nicht einverstanden sind, können tatsächlich das geringste Problem im Leben eines Paares sein. Wenn beide nämlich von unterschiedlichen, außerdem noch miteinander im Krieg befindlichen Völkern abstammen, ein Kind aus dieser Verbindung hervorgegangen ist und die kleine Familie durch die Galaxis gejagt wird, sind Eltern wirklich das allerletzte Problem, um das man sich Sorgen machen muss. Riesen können zum Beispiel ein Problem sein. Nackte Riesen. Oder Roboter mit homoerotischen Träumen. Ein Kopfgeldjäger, sogar einer der besten auf seinem Gebiet, darf ebenfalls nicht vergessen werden. Alana und Marko, die Eltern auf der Flucht, haben es gewiss nicht leicht. Das wissen sie spätestens, als sie eine der ungewöhnlichsten Geburten des Universums erleben. Und in diesem Universum ist schon vieles ungewöhnlich. Aber das?!
Eltern, die mit der Verbindung zum jeweiligen Partner nicht einverstanden sind, können tatsächlich das geringste Problem im Leben eines Paares sein. Wenn beide nämlich von unterschiedlichen, außerdem noch miteinander im Krieg befindlichen Völkern abstammen, ein Kind aus dieser Verbindung hervorgegangen ist und die kleine Familie durch die Galaxis gejagt wird, sind Eltern wirklich das allerletzte Problem, um das man sich Sorgen machen muss. Riesen können zum Beispiel ein Problem sein. Nackte Riesen. Oder Roboter mit homoerotischen Träumen. Ein Kopfgeldjäger, sogar einer der besten auf seinem Gebiet, darf ebenfalls nicht vergessen werden. Alana und Marko, die Eltern auf der Flucht, haben es gewiss nicht leicht. Das wissen sie spätestens, als sie eine der ungewöhnlichsten Geburten des Universums erleben. Und in diesem Universum ist schon vieles ungewöhnlich. Aber das?!
Inzwischen ist ein Punkt in der Geschichte erreicht, in der SAGA nicht mehr mit Star Wars verglichen werden kann, der Vergleich hinkt sogar. Neben ein paar tragischen Momenten setzt SAGA weitaus mehr auf Comedy, als es noch im ersten Band der Fall war. Ein szenisches Zitat erinnert an Lexx. Manches ist abgedrehter, als es ein Film wie Barbarella je war. Action wird durch nichts begrenzt. Das Markenzeichen dieser Serie, grenzenlos mögliche Kreaturen, lässt Kämpfe, Auseinandersetzungen im großen und kleinen Stil, in allerlei Wahnwitzigkeiten ausarten. Diese sind absolut sehenswert. Der Leser darf sich oft überraschen lassen, vielleicht auch schockieren (das dürfte aber bei der Zielgruppe von SAGA eher nicht der Fall sein).
Brian K. Vaughan vertieft die Hintergrundgeschichte der beiden Liebenden, erzählt über ihr Kennenlernen und jenes Ereignis, den Akt, der überhaupt erst zum Auslöser von SAGA wurde: das Kind. Letztlich bleibt es nicht bei einem Kind. Ein weiteres wird bei seiner Geburt sogleich zum Zerstörer, ein anderes erwärmt ein scheinbar kaltes Herz und wird zum Begleiter eines Kopfgeldjägers. Die Handlung teilt sich in die Sichtweisen von Gejagten und Jägern. Letztere, der Freilanzer Der Wille wie auch Prinz Robot IV, eine humanoide Kreatur mit einem 70er-Jahre-Fernseher als Kopf, agieren aus unterschiedlichen Motiven, die sich mit der Zeit sogar verschieben. Man könnte sagen, ein schlichter Jagdauftrag wird für beide persönlich.
Fiona Staples hat ihre Figuren derart gut im Griff, dass bereits wie kleine Schauspieler agieren, sich auch geradezu für eine Verfilmung empfehlen (Heath Ledger und Shannyn Sossamon wären vor einigen Jahren das Traumpaar für die Besetzung der Hauptrollen gewesen. Wer weiß, woher die optische Inspiration für die beiden Charaktere stammt.) Staples lehnt sich mit ihren Kreaturen an die Realität an, macht aus Maulwürfen Sicherheitsleute, kreiert auf einer Doppelseite eine grafisch beeindruckende Geburt und vervollkommnet die Hauptcharaktere zur lebendigen Perfektion.
Mein persönliches Sahnehäubchen dieser Ausgabe sind die Wehweiber. Selten waren Hexen gruseliger und mit einem simplen Trick einfallsreicher. Dies wird hier einzig noch durch die Auflösung der Szene überboten, in der sich jemand etwas besonderes einfallen lässt, um der gefahrvollen Situation zu entkommen. Noch schöner, am schönsten, aber natürlich auch gestalterisch aufwendiger fallen die Titelbildillustrationen von Fiona Staples aus, die den einzelnen Kapitel voran gestellt sind. Hier beeindruckt sie mit einer tollen grafischen Eleganz und dem fotografischen Blick für den richtigen Moment.
Eine Odyssee im wahrsten Sinne. Haken schlagend geht die Reise der Flüchtlinge weiter, deren Zahl nun zugenommen hat. Entsprechend sind die Verfolger auch mehr geworden und ihre Motivation hat sich deutlich verändert. Brian K. Vaughan zeigt, was passieren kann, wenn ein Erzähler seine Phantasie von der Leine lässt und eine talentierte wie auch technisch versierte Künstlerin an seiner Seite hat. Top! 🙂
Saga 2: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 25. Juli 2013
 Der menschliche Geist, vielfach erforscht und doch gibt es so viel zu lernen und zu erfahren. Die vielfältigen Abläufe des Gehirns, das komplexe Zusammenspiel einer inneren und einer äußeren Welt hat sich bisher, sehr zum Verdruss mancher Institution, einer genauen Steuerung von außen, einer regelartigen Verhaltensweise entzogen. Die Willkür des menschlichen Geistes wird zur Bedrohung, so scheint es und einige Mächtige im Hintergrund sind nicht gewillt, die Menschheit wie einen führerlosen Zug in die Zukunft rasen zu lassen, an deren Ende nur eines warten kann … Auslöschung? Was wie ein Experiment beginnt, erinnert auch an ein Spiel. Selbst jene, die das Experiment leiten, sind sich nicht im Klaren über den genauen Verlauf. Nur einer scheint den Überblick zu besitzen: A.D.A.M.
Der menschliche Geist, vielfach erforscht und doch gibt es so viel zu lernen und zu erfahren. Die vielfältigen Abläufe des Gehirns, das komplexe Zusammenspiel einer inneren und einer äußeren Welt hat sich bisher, sehr zum Verdruss mancher Institution, einer genauen Steuerung von außen, einer regelartigen Verhaltensweise entzogen. Die Willkür des menschlichen Geistes wird zur Bedrohung, so scheint es und einige Mächtige im Hintergrund sind nicht gewillt, die Menschheit wie einen führerlosen Zug in die Zukunft rasen zu lassen, an deren Ende nur eines warten kann … Auslöschung? Was wie ein Experiment beginnt, erinnert auch an ein Spiel. Selbst jene, die das Experiment leiten, sind sich nicht im Klaren über den genauen Verlauf. Nur einer scheint den Überblick zu besitzen: A.D.A.M.
Weltweit werden Menschen entführt. Die Auswahl ist scheinbar willkürlich. Sie verschwinden einfach und finden sich zusammen in einer Art Gefängnis. Zuerst protestieren sie. Sie haben Angst. Sie verweigern sich. Versuchen zu entkommen. Bis sie sich in das Unvermeidliche fügen. Fast alle. Was wäre wenn? Experimente mit Menschen, Erwachsenen wie auch Kindern, sind nicht neu und in den weiten Bereichen rund um das menschliche Gehirn und dem Verhalten in bestimmten Situationen immer wieder gern probiert. So werden diesen Probanden getestet und Situationen ausgesetzt, die insbesondere gern an Charakteren rüttelt. Die Versuchsanordnung, die von Richard Marazano (Der Schimpansenkomplex) hier ersonnen wurde, ist ein wirklich gruseliger Ausgangspunkt.
Das Gefängnis, dem Umstand nach zweifellos ein solches, gewinnt durch eine Umbenennung kaum an Qualität, erhält aber einen etwas freundlicheren Charakter, indem die Insassen neutraler als Einheiten, die Bewacher als Kameraden, die experimentierenden Ärzte als Berater bezeichnet werden. Allesamt sind sie die Bewohner. Richard Marazano beschreibt eine Hölle für Menschen, die sich offensichtlich nichts haben zu schulden kommen lassen und sich nun zur Hilflosigkeit verdammt sehen. Denn neben der ungeklärten Frage nach dem Warum für ihren Gefängnisaufenthalt, haben sie auch keine Ahnung Wo sie sich befinden.
Jean-Michel Ponzio, der zusammen mit Richard Marazano schon Der Schimpansenkomplex schuf, hat es hier mit einer Geschichte zu tun, die weniger mystisch, dafür umso menschlicher in Szene gesetzt wird. Die Umgebung des Gefängnisses ist kalt, stählern, eisern, wie das Innere einer längst verlassenen Fabrik, die eigens zu diesem Zweck umgebaut oder angepasst wurde. Jean-Michel Ponzio arbeitet stilistisch, als setze er eine Fotoserie in Zeichnungen um. Jede Figur ist zu jeder Zeit, in jeder Haltung und Perspektive wiedererkennbar. Es ist eine grafische Lösung, die sich keinen Fehltritt, keinen falschen Strich leistet. Es ließe sich auch sagen, dass Ponzio die optische Dokumentation für seine Zusammenarbeit mit Marazano entdeckt hat.
Diese Stilistik, die durchaus auch sehr kühl ist, sezierend, nüchtern, klar setzt jeden vorkommenden Charakter den voyeuristischen Blicken des Lesers aus. Jeder Charakter, Kameraden und Berater eingeschlossen, ist auf dem Prüfstand. Das ist bei der klinischen Atmosphäre binnen kurzer Zeit gruselig, ein unheimlicher Thriller, der auch durch die Zwielichtfarben, die vorherrschende künstliche Beleuchtung im Inneren des Gefängnisses befördert wird. Tageslicht dringt in den Innenbereich dieses Ortes nicht vor.
Die Vorgeschichte, oder auch Einleitung, ist kurz. Zwischeneinschübe (nicht jeder Mensch kann so einfach verschwinden, ohne dass nicht wenigstens einen gibt, dem dieses Verschwinden auffällt) zeigen die Welt außerhalb des Gefängnisses. In der relativ nahen Zukunft handelnd, präsentiert sich Hoffnungslosigkeit in smoggelbem Licht, leicht diesig. Drinnen oder draußen, ob Macht oder Ohnmacht, so geben es die Bilder wieder, es ist sich alles eins und macht keinen Unterschied.
Faszinierend. Kann mehrmals gelesen werden, ist vielschichtig, auch zwischen den Zeilen. Richard Marazano hat seine Technik für Plot, komplexe Handlung und Charaktere einmal mehr perfektioniert. Technisch perfekte Zeichnungen komplettieren diesen SciFi-Thriller und Auftakt einer vierteiligen Erzählung. 🙂
Pelikan Protokoll 1, Erste Phase: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 02. April 2013
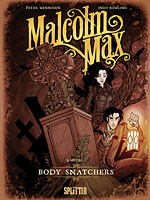 Im Jahre 1889 sind Leichen zu einer ganz besonderen Ware geworden. Zum Zwecke anatomischer Studien lassen sich Leichen gut verkaufen. Leichendiebe sind sogar auf den Friedhöfen unterwegs und rauben Gräber aus. Malcolm Max und seine Gehilfin Charisma Myskina verfolgen eine heiße Spur. Nachts auf einem Friedhof in London versuchen sie einige dieser Ganoven bei ihrer Arbeit zu beschatten, um den Drahtzieher hinter den Leichenrauben zu fangen. Leider kommt ihnen eine übereifrige Journalistin namens Fiona Pankhurst in die Quere, die zwar mutig, aber auch sehr sorglos ein Foto der Grabschänder schießt. Kurz darauf ist sie samt ihrer sperrigen Kamera auf der Flucht. Mit wehendem Rock ist das Fliehen jedoch keine leichte Aufgabe und es wäre nicht geglückt, gäbe es nicht einen Malcolm Max, der galant und tatkräftig zur Seite seht.
Im Jahre 1889 sind Leichen zu einer ganz besonderen Ware geworden. Zum Zwecke anatomischer Studien lassen sich Leichen gut verkaufen. Leichendiebe sind sogar auf den Friedhöfen unterwegs und rauben Gräber aus. Malcolm Max und seine Gehilfin Charisma Myskina verfolgen eine heiße Spur. Nachts auf einem Friedhof in London versuchen sie einige dieser Ganoven bei ihrer Arbeit zu beschatten, um den Drahtzieher hinter den Leichenrauben zu fangen. Leider kommt ihnen eine übereifrige Journalistin namens Fiona Pankhurst in die Quere, die zwar mutig, aber auch sehr sorglos ein Foto der Grabschänder schießt. Kurz darauf ist sie samt ihrer sperrigen Kamera auf der Flucht. Mit wehendem Rock ist das Fliehen jedoch keine leichte Aufgabe und es wäre nicht geglückt, gäbe es nicht einen Malcolm Max, der galant und tatkräftig zur Seite seht.
Aber es ist nicht die Nacht von Fiona Pankhurst. Der langjährige Autor von Gespenstergeschichten, Peter Mennigen, stellt seine interessante Frauengestalt, emanzipiert und forsch, auf schöne Weise vor, bevor er sie nach allen Regeln gruseliger Kunst, als eher prominentes Opfer entlässt. Malcolm Max, ein Ermittler in den dunklen Gefilden des viktorianischen Zeitalters, erblickte zunächst im Hörspiel das Licht der Unterhaltungswelt und betätigt nun mit dem ersten Band einer neuen Comic-Reihe einen weiteren, sehr guten Schritt. Durch den Illustrator Ingo Römling entsteht eine modern und technisch sehr versiert gestaltete Geschichte, die Auge und lesefreudiges Hirn anspricht.
Malcolm Max will nicht nur betrachtet, sondern auch gelesen werden. Neben einigen sehr humorvollen Passagen, auch gegen den Strich eingebaut, wie gerade jene erste Kussaufforderung von Charisma Myskina zeigt, breitet sich eine Atmosphäre aus, wie sie gerade neuere Publikationen des Genres gerne verwenden. Gruselig charmant, mit spitzen Stift, zwischen kantig und weich werden Fans von Stilistiken eines Mike Mignola (Hellboy) oder eines Rob Guillory (Chew) sofort Gefallen an den Bildern von Ingo Römling finden. Allerdings stilisiert er nicht ganz so stark wie seine Kollegen und bleibt noch in der Nähe seiner Entwurfskizzen, die noch deutlich realistischer als das Endprodukt ausfallen.
Das erste Comic-Album: Angesichts der Qualität des ersten Bandes von Malcom Max stellt sich eigentlich nur eine Frage: Warum erst jetzt? Ingo Römling arbeitete schon im Gruselbereich (Die Toten), doch eine Geschichte von dieser Länge war noch nicht dabei. Malcolm Max ist als Figur ein langer Schlacks, mit ebenfalls länglichem Gesicht (und einer gewissen Ähnlichkeit zu einem in meinem Raum bekannten Schauspieler, Adrian Linke) und einer dandy-haften Gestalt. Interessant ist, wie auch die Collage von verschiedenen Personen im gesellschaftlichen Treiben am Theater oder bei Ausstellungen verwendet wird. Hier finden sich Bildaufbauten wie sie auch in der so genannten Bildenden Kunst späterer Jahrzehnte beliebt gewesen sind.
Im Sinne von Gruselgeschichten neuerer wie auch klassischer Machart gibt es allerhand Motive zu entdecken. Anspielungen auf Das Schweigen der Lämmer oder Im Auftrag des Teufels sind ebenso zu finden wie das Einschleichen so ungewöhnlicher Themengebiete wie Voodoo. Letztlich greift optisch alles sehr schön ineinander, so dass ein sehr geschlossenes und damit sehr ansprechendes Werk entsteht.
Ein Nachteil: Wie die Titelgebung des Bandes verrät, handelt es sich um Kapitel 1, nicht Buch 1 und so endet dieses Album erst einmal mit einem gemeinen Cliffhanger und einer Menge unaufgelöster Fragen. Freunde viktorianischer Geschichten, auch andere versierte Leser werden vielleicht erste Schlüsse ziehen, auflösen werden sie jedoch erst Peter Mennigen und Ingo Römling.
Toller Auftakt, aus deutschen Landen endlich einmal wieder und es zeigt sich, dass sich Produktionen hierzulande nicht hinter dem frankobelgischen Kollegium zu verstecken brauchen. Erzählung, Spannung, Bildsprache und Technik fesseln von der ersten bis zur letzten Seite. Ein fein aufbereiteter Anhang bietet einen schönen Blick in die Entstehung des vorliegenden Bandes und der Hauptfiguren. 🙂
Malcolm Max, Kapitel 1, Body Snatchers: Bei Amazon bestellen
Sonntag, 24. Februar 2013
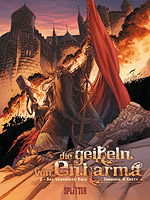 Vor der Nahrungsaufnahme steht die Jagd. Man kann sie elegant bestreiten, als Gestaltwandler in Form einer Raubkatze oder man es sie plump angehen. Mit einer Steinaxt auf hühnergroße Vögel. Von denen nach einem satten Schlag nichts mehr zum Verzehr übrig bleibt. Raulnir schiebt die Schuld für das Jagdversagen gerne beiseite. Da trifft es sich, dass Fanta, die Gestaltwandlerin, erfolgreicher war und die Gruppe dennoch satt wird. In den Ruinen von Sirfall sind die Nöte des Hungers nur noch nebensächlich. Diese versunkene Zivilisation kündet von der Macht des Monsters, einem untoten Drachen, der ein Reich in der Blüte seiner Zeit zugrunde richtete. Welche Chancen sollen da ein paar Söldner haben, wenn es einem ganzen Volk nicht gelang, das Übel aufzuhalten?
Vor der Nahrungsaufnahme steht die Jagd. Man kann sie elegant bestreiten, als Gestaltwandler in Form einer Raubkatze oder man es sie plump angehen. Mit einer Steinaxt auf hühnergroße Vögel. Von denen nach einem satten Schlag nichts mehr zum Verzehr übrig bleibt. Raulnir schiebt die Schuld für das Jagdversagen gerne beiseite. Da trifft es sich, dass Fanta, die Gestaltwandlerin, erfolgreicher war und die Gruppe dennoch satt wird. In den Ruinen von Sirfall sind die Nöte des Hungers nur noch nebensächlich. Diese versunkene Zivilisation kündet von der Macht des Monsters, einem untoten Drachen, der ein Reich in der Blüte seiner Zeit zugrunde richtete. Welche Chancen sollen da ein paar Söldner haben, wenn es einem ganzen Volk nicht gelang, das Übel aufzuhalten?
Mal ehrlich, wenn es legendäre Auftragsmörder und Söldner gibt, die kaum einer jemals gesehen hat, die aber in aller Munde sind, würde man die Gelegenheit als unbekannter Auftragsmörder und Söldner nutzen, um diese bekannten Identitäten anzunehmen und so Nutzen aus einer gewissen Prominenz zu ziehen? Würde man so etwas tun? Nun, jemand, der intelligent genug ist, um die möglichen Konsequenzen zu erkennen, würde so etwas nicht machen. Glücklicherweise, für den Leser selbstverständlich, sind jene, die sich für Die Geißeln von Enharma ausgeben, nicht ganz so schlau. Allerdings sind sie ebenso rücksichtslos, kaum weniger gewalttätig und wollen wie alle anderen in dieser fremden Welt überleben.
Sylvain Cordurie hat eine Gruppe zusammengestellt, wie sie kaum unterschiedlicher zusammengesetzt sein könnte und sicherlich, neben den Fantasy-Comic-Fans, auch Fantasy-Rollenspieler begeistern sollte. Eine Gestaltwandlerin, ein Zauberer, der mehr schlecht als recht in der Magie bewandert ist, ein Hau-drauf, ein Untoter und ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen gegen den Rest der Welt. Genauer: gegen ein großes Monster, sehr großes Monster und die Plage der Untoten, die damit einher geht. Die Sirfalliten könnten eine Möglichkeit der Gegenwehr kennen, sind aber nicht die besten Verbündeten.
Dieses Volk, von Stephane Crety wie Abkömmlinge von Mandrills gestaltet, mag, urig wie es ist, auch an Pikten erinnern. Gruseliger, sehr modern und in jedem neuen Horrorfilm einsetzbar, sind die geflügelten Ghule, deren Leckerbissen Untote sind, die aber auch gerne selbst für Nachschub sorgen und sich an Lebende heranmachen. Aus einer abenteuerlichen Phase wird so ein toll gezeichnetes, neudeutsch gesagt, Horror-Event. Aber das ist nur der eine Handlungsstrang. Der andere führt dem Leser die Macht des Monsters vor Augen und präsentiert außerdem ein Fahrzeug, das frühe Warcraft-Enthusiasten ebenfalls Vergleiche ziehen lassen wird.
Ein walähnliches Wesen, mit einem Aufsatz auf dem Rücken, der eine Besatzung aufnehmen kann, dient zur Flucht aus einer umkämpften Stadt. Das letzte Drittel des zweiten Teils dieser Trilogie ist eine infernalische Sequenz, die keine Zeit zum Luftholen lässt. Eine optische Achterbahnfahrt entlockt den Helden letzte Kraftanstrengungen, die vorführen, wie gut sie es dann doch noch gelernt haben, sich als Gruppe durchzusetzen. Dabei wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie sehr bald alle ihre Kräfte noch brauchen werden. Die Farbenpracht, von Simon Champelovier aufgetragen, verwendet eine zurückhaltende Palette, lasierend, auf Natürlichkeit bedacht. Die Qualität des Titelbildes findet sich auf dem selben Niveau im Innenteil wieder.
Eine sehr gelungene Fortsetzung einer Halunkengeschichte im Fantasy-Milieu. Neben Abenteueratmosphäre findet sich Horror und eine sehr dichte Weltuntergangsstimmung. Spannend erzählt, von Stephane Crety mit sehr eigenem Stil gezeichnet. Fein. 🙂
Die Geißeln von Enharma 2, Das verrückte Volk: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 22. Dezember 2011
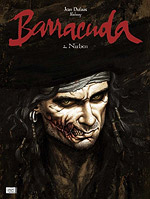 Der junge Mann erkennt die Frau sofort wieder. Sie hat Schuld daran, dass er nicht mit seinem Vater auf See sein kann, sondern auf dieser Insel im Müßiggang auf die Rückkehr des Schiffes warten muss. Er greift sich die nächstbeste Waffe, übersieht sogar die Pracht seiner Umgebung, rennt an den Strand, um dort regelrecht übermannt zu werden und seine Rachsucht erstickt zu sehen. Alles wegen einer Frau, wegen der Frau, gegen die nicht nur er machtlos ist.
Der junge Mann erkennt die Frau sofort wieder. Sie hat Schuld daran, dass er nicht mit seinem Vater auf See sein kann, sondern auf dieser Insel im Müßiggang auf die Rückkehr des Schiffes warten muss. Er greift sich die nächstbeste Waffe, übersieht sogar die Pracht seiner Umgebung, rennt an den Strand, um dort regelrecht übermannt zu werden und seine Rachsucht erstickt zu sehen. Alles wegen einer Frau, wegen der Frau, gegen die nicht nur er machtlos ist.
Hass ist die treibende Kraft. Liebe spielt eher eine untergeordnete Rolle. Allenfalls Leidenschaft spornt die einzelnen Menschen, jeden auf seine Weise, an. Entstand zu Beginn der Reihe noch das Gefühl, als sei des Piraten oberstes Gebot, Reichtum zu mehren und deshalb Schiffe zu überfallen, wandelt sich dieses Bild mit der Fortsetzung gehörig. Jeder einzelne Charakter trachtet nach seiner persönlichen Rache. Dona del Scuebo, die als Sklavin verkauft wurde, frönt ihrer Rache täglich, indem sie ihren Herrn erniedrigt und zum Gespött macht. Andere müssen noch ein wenig warten, bis sie am Ziel dieser Wünsche sind. Mit der Landung des Kapitäns Morkam (siehe Titelbild) setzt sich eine immer schneller ablaufende Spirale in Gang.
Feinde treffen wieder aufeinander: Autor Jean Dufaux entschlüsselt einige Motivationen seiner Figuren. Manche sind edler Natur, aber nicht uneigennützig. Die meisten wollen ein Ziel erreichen und verletzen auf diesem Weg mit Worten und Waffen. Nur wenige halten sich vornehm im Hintergrund und harren der Dinge, die da bald ausbrechen werden. Dufaux betitelt die zweite Folge mit Narben. Ebenso gut hätte er es Tanz auf dem Vulkan nennen können.
Das Netz aus Begierden und Abstoßung wird von Jeremy weiterhin brillant in Szene gesetzt. Es wirkt wie eine Vervollkommnung eines Manga-Stils, mit mehr Nuancen allerdings. Beste Beispiele sind die Figuren von Mr. Flynn und seines Mündels, die auch in entsprechenden Manga-Genreproduktionen eine herausragende Stellung einnehmen würden. Neben der sehr realistischen Darstellung von Menschen lebt die Geschichte von einer sehr schön gestalteten Ausstattung, modischen Ansichten jener Epoche und natürlich dem Flair einer karibischen Insel, die jedoch nur oberflächlich eine Idylle ist.
Doch bevor es in die Wildnis geht, überrascht Jeremy mit den Spitzen der Zivilisation jener Tage, die sich besonders in Gotteshäusern äußerte. In aller Pracht zeigt uns der Künstler den spanischen König vor einer Altarwand, im Gebet versunken, bevor die Handlung, weitaus gruseliger, an ein Totenbett fortschreitet und den Grundstein für spätere Ereignisse gelegt werden. Eindringlich lassen sich diese Bilder nennen, die das Piratengenre hervorragend aufgreifen. Sie besitzen auch ein romantisches Element, ein furchtbares und nehmen, moderne Stoffe kommen selten ohne aus, eine sexuelle Komponente hinzu, die mal mehr, mal weniger stark thematisiert wird.
Das Finale soll hier natürlich nicht verraten werden. Dennoch verdient es eine ausdrücklich Erwähnung, da es optisch wie erzählerisch höchst gelungen, spannend inszeniert und ineinander verschachtelt ist. Hier haben sich Dufaux und Jeremy zweifellos von filmischen Techniken inspirieren lassen. Der Eindruck ist sicherlich modern zu nennen, aber auch passend, der der Szenerie Schnelligkeit verliehen wird, ohne den Leser zu hetzen. Im Gegenteil fügt Dufaux auch bremsende Elemente ein, die zum Schmunzeln einladen, während es parallel dazu um Leben und Tod geht. Damit trifft Dufaux jedoch das Herz vieler Piratenerzählungen.
Weiterhin packend erzählt: Dufaux präsentiert Einzelschicksale, Rachegeschichten und baut im Hintergrund an politischen Plänen, von denen einige Charaktere noch nicht einmal ahnen können, dass sie darin verstrickt werden. Bestens und mit viel Liebe zum Genre von Jeremy illustriert. 🙂
Barracuda 2, Narben: Bei Amazon bestellen
Sonntag, 29. Mai 2011
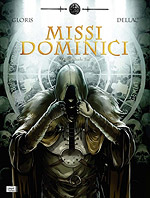 Malassah will Blut sehen. Noch gibt es genügend Gefangene und Sklaven, die dem finsteren Gott, einem Feind des Christengottes geopfert werden können. Mehr noch: Für jeden getöteten Krieger der Liven soll ein Gefangener sterben. Durch die Hilfe ihres Gottes wie auch seines Sohnes Jelami, einem irdischen Jungen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wollen sie die Germanen besiegen. Langsam wachsen in Jelami jedoch Zweifel an seiner Funktion. Er sieht das Grauen der Opferzeremonien und verfolgt die Gräueltaten mit immer größerem Abscheu. In der Tat ist der Junge für die Männer, die hinter den Kulissen ihre Fäden ziehen, nur ein Werkzeug. Und noch haben sie genug Macht über ihn, um ihre Ziele weiterzuverfolgen.
Malassah will Blut sehen. Noch gibt es genügend Gefangene und Sklaven, die dem finsteren Gott, einem Feind des Christengottes geopfert werden können. Mehr noch: Für jeden getöteten Krieger der Liven soll ein Gefangener sterben. Durch die Hilfe ihres Gottes wie auch seines Sohnes Jelami, einem irdischen Jungen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wollen sie die Germanen besiegen. Langsam wachsen in Jelami jedoch Zweifel an seiner Funktion. Er sieht das Grauen der Opferzeremonien und verfolgt die Gräueltaten mit immer größerem Abscheu. In der Tat ist der Junge für die Männer, die hinter den Kulissen ihre Fäden ziehen, nur ein Werkzeug. Und noch haben sie genug Macht über ihn, um ihre Ziele weiterzuverfolgen.
Es tobt ein geheimer Krieg, hinter dem Krieg. Diejenigen, die mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet wurden, bedienen sich der Normalsterblichen für ihre Zwecke. Aber manchmal ist es auch genau umgekehrt. Wenn die Normalsterblichen doch eine besondere Fähigkeit besitzen, nämlich jene, die Vertrauen haben, zu überzeugen, zu täuschen. Die beiden Ritter der Missi Dominici, jener Geheimorganisation, die danach trachtet, alle jene mit besonderen Fähigkeiten unter ihrem Mantel zu vereinen, sucht jene, gerade junge Menschen, die noch nicht wissen, dass sie gesegnet sind, um sie nicht zum Werkzeug des Bösen werden zu lassen. Aber nicht alle wollen ihre jeweilige Macht für das Gute einsetzen.
Gemäß des Prinzips der Gegensätze gibt es auch eine Gruppe, die ihre Macht nur zu ihrem eigenen Nutzen einsetzt. Diese Konstellation zeigte Autor Thierry Gloris in der ersten Ausgabe von Missi Dominici und beleuchtet nun neben dem Fortgang der Handlung insbesondere die Vergangenheit des Ritters Wolfram, der sich bisher durch großen Kampfgeist und Mut hervortat und dabei gleichzeitig ein ziemliches Raubein war. Gloris erschafft einen von Gott verlassenen Mann, dessen Kindheit ein Alptraum war, der nur das Überleben gelernt hat und am Ende zu dem wird, was er gefürchtet und verabscheut hat.
Thierry Gloris lässt seinen Helden jedoch nicht ins Leere laufen, sondern schafft einen Wendepunkt. Das neue Leben wird ungewohnt und zunächst wieder mühevoll, aber schließlich dankbarer. Die Rückblicke, wie der gesamte Band von Benoit Dellac gezeichnet, werden in seinem Sepiaton von Anouk Bell koloriert. Diese episodenhaft eingestreuten Eindrücke von Wolframs Vergangenheit sind einerseits in Form einer mittelalterlichen Realität erzählt, andererseits rücken die mysteriösen Aspekte immer mehr in den Vordergrund.
Die Missi Dominici trachten nach Erweiterung ihres Verbundes. Als die beiden Helden ihr Ziel erreichen, kann auch der weitaus jüngere Mann des Duos, de Guivre, seine Fertigkeiten zeigen. Wieder einmal geht es in die Vergangenheit, in geisterhaftes Blau getaucht. Und Thierry Gloris lässt seine Helden scheitern. Mit fortschreitender Geschichte wird die Handlung nicht nur unheimlicher, auch gruseliger, sondern nimmt auch mehr Fahrt auf. Ob Gloris Vorbilder bei anderen Erzählern findet, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, manche Szene kann jedoch als eine Art Hommage gedeutet werden.
Benoit Dellac versteht sich auf eine klassische grafische Darstellung im Stile eines oder auch eines . Männliche Figuren sind sehr markant gezeichnet, Frauenfiguren wirken stilistisch allerdings eher wie an Mangadarstellungen angelehnt. Die Technik ist abwechslungsreich. Fette, sehr dichte Strichführungen finden sich ebenso wie leichte, zerbrechliche. Benoit Dellac trägt dabei auch der jeweiligen Stimmung Rechnung, wie sich besonders an einem geisterhaften Rückblick ablesen lässt. Leider kommt es zu selten zu sehr raumgreifenden Bildern, halbseitig oder größer, denn hier kann Benoit Dellac richtig aus dem Vollen schöpfen und sein Talent für Breitwandbildkompositionen beweisen.
Spannend von Anfang bis Ende, ein echter Seitenumblätterer. Mittelalterliches Szenario gepaart mit Mystery, aus der nach und nach eine handfeste Gruselgeschichte wird, mit ein wenig Indiana-Jones-Atmosphäre. 🙂
Missi Dominici 2, Tod: Bei Amazon bestellen
Mittwoch, 26. Januar 2011
 Sind Sie tot, Madame? Die Antwort auf diese Frage erhält Detektiv Deschamps, kurz Dede, natürlich nicht mehr von der vor ihm im Sesselsitzenden alten Frau. Denn die ist tatsächlich verstorben. Wann und wie entzieht sich seiner Kenntnis. Dede ist noch voller Verwunderung, als eine mysteriöse Anruferin ihn zu einer weiteren Adresse schickt. Wieder erwartet ihn eine Tote, in entspannter Haltung, von Verwesung keine Spur. Es ist nicht so, als würde Dede seinen Beruf nicht mögen, schließlich lebt er davon. Aber in die Irre geführt, vielleicht auch zum Narren gehalten zu werden, übersteigt seine Geduld. Doch seine Auftraggeberin gibt nicht auf. Und so ist er am nächsten Tag wieder bei der Arbeit und folgt auf der merkwürdigen Spur.
Sind Sie tot, Madame? Die Antwort auf diese Frage erhält Detektiv Deschamps, kurz Dede, natürlich nicht mehr von der vor ihm im Sesselsitzenden alten Frau. Denn die ist tatsächlich verstorben. Wann und wie entzieht sich seiner Kenntnis. Dede ist noch voller Verwunderung, als eine mysteriöse Anruferin ihn zu einer weiteren Adresse schickt. Wieder erwartet ihn eine Tote, in entspannter Haltung, von Verwesung keine Spur. Es ist nicht so, als würde Dede seinen Beruf nicht mögen, schließlich lebt er davon. Aber in die Irre geführt, vielleicht auch zum Narren gehalten zu werden, übersteigt seine Geduld. Doch seine Auftraggeberin gibt nicht auf. Und so ist er am nächsten Tag wieder bei der Arbeit und folgt auf der merkwürdigen Spur.
Ein neuer Ermittler betritt die Szene: Dede. In Paris, Dede beweist es einmal mehr, weiß man das Leben zu lieben und Gemütlichkeit, eine Partie Schach, ein Glas Wein gehören einfach dazu. Aus dieser Gemütlichkeit wird Dede gleich zu Beginn herausgerissen. Seine Zielorte besitzen gleichfalls eine gewisse Gemütlichkeit, nur die Belebtheit fehlt ihnen.
Frank Erik Weißmüller, kurz Erik, versetzt den klassischen Detektiven mit Trenchcoat in die Neuzeit. Dede ist ein wenig schnodderig, natürlich kennt er die Menschen, so wie Detektive nun einmal die Menschen kennen. Überrascht ist er aber doch hin und wieder. Dieser Fall gehört dazu. Hier geht es nicht um das große Geheimnis, hier geht es um Menschen, die sehr egoistisch handeln und dafür über Leichen gehen. Ein ebenso klassischer Mordfall eben.
Erik erzählt den Krimi mit Gespür für Humor. Die Blicke in die Gesichter der Toten, die den Detektiven immer anzugrinsen scheinen, der kleine Junge, der Dede aufhält, ein gruseliger Traum lockern auf und bilden schöne Zwischenschritte hin zu einem ausgedehnten Finale, wie es sich für einen Krimi gehört. Grafisch entwirft Erik seine Bilder und Seiten klassisch per Bleistift (wie sich auch wunderbar anhand der Skizzen seines Webcomics DEAE EX MACHINA sehen lässt). Über die Tuschearbeit erfolgt allerdings eine leichte Abstrahierung. Der Tuscheauftrag wirkt verspielt, wellig. Was sich in der Skizze sehr geschlossen ausgenommen haben mag, sieht in der getuschten Fassung zusammengesetzt, konstruiert, auch sehr kühl aus. Daraus entsteht eine Atmosphäre, wie sie aus alten in schwarzweiß gefilmten französischen Krimis her bekannt ist und hier etwas parodiert wird.
Die Kolorierung ist sehr zurückhaltend ausgeführt und nimmt eine enge Farbpalette in Anspruch. So kühl die Konstruktion der Zeichnungen durch die Tusche wirkt, so sehr unterstützen die Farben diesen Eindruck. Ocker, kaltes Grau und Braun, ein sehr helles Gelb, blasses Blau und Rot geben der Szenerie ein nächtliches Ambiente, selbst in den Tagesszenen. Eine Schattierungstönung oder auch ein Lichtauftrag jeweils genügen zur räumlichen Gestaltung.
Ein vergnüglicher Auftakt mit einem knurrigen jungen Detektiven aus Paris. Das Flair von Klassikern des Genres verbunden mit francobelgischem Humor und technisch versierten Zeichnungen. Das passt! 🙂
DEDE 1, Sind Sie tot, Madame: Bei Amazon bestellen
Link: Eriks DEAE EX MACHINA (Webcomic)
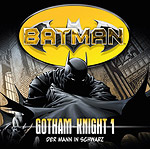 Die Gangster sind nicht dumm. Der Mann in Schwarz hat sich technische Spielzeuge zugelegt, die auch Batman gefährlich werden können. Aber warum das Risiko unnötig in die Höhe treiben? Wenn man auch per Jetpack frühzeitig entkommen kann? Aber die Farbe Schwarz? Warum? Die Antwort sollte Batman nicht erstaunen und doch wundert sie ihn ein wenig. Viel Zeit kann er trotzdem nicht auf die Analyse von feindlichen Beweggründen verwenden. In Gotham City ist der Teufel los, im übertragenen Sinne zwar, aber Gegner wie Scarecrow geben sich die größte Mühe dem Original so nahe wie möglich zu kommen.
Die Gangster sind nicht dumm. Der Mann in Schwarz hat sich technische Spielzeuge zugelegt, die auch Batman gefährlich werden können. Aber warum das Risiko unnötig in die Höhe treiben? Wenn man auch per Jetpack frühzeitig entkommen kann? Aber die Farbe Schwarz? Warum? Die Antwort sollte Batman nicht erstaunen und doch wundert sie ihn ein wenig. Viel Zeit kann er trotzdem nicht auf die Analyse von feindlichen Beweggründen verwenden. In Gotham City ist der Teufel los, im übertragenen Sinne zwar, aber Gegner wie Scarecrow geben sich die größte Mühe dem Original so nahe wie möglich zu kommen.