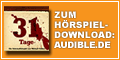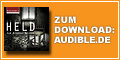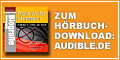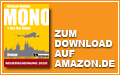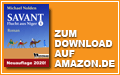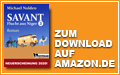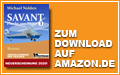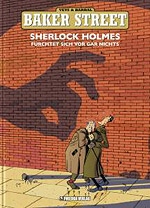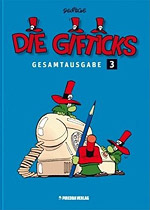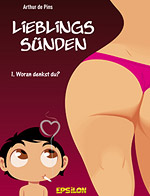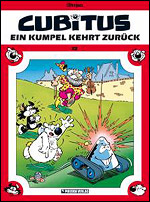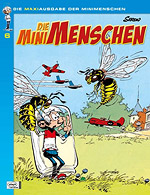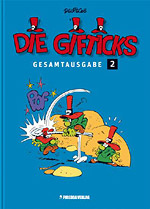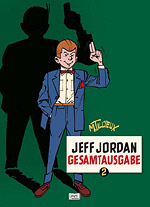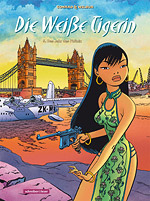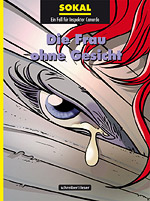Montag, 26. April 2010
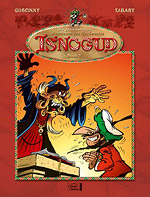 Ein kleines Männlein kommt aus der Hölle (nein, nicht Isnogud) und muss voller Verwunderung feststellen, dass der Großwesir immer noch Unterwürfigkeit heuchelt. Zwar strengt sich Isnogud immer noch hartnäckig an, sein Ziel zu erreichen (Kalif werden anstelle des Kalifen), aber irgendwie mangelt es an der dazu nötigen Portion Glück. Glück sollte der Großwesir denn auch wenigstens an seinem Geburtstag haben: Aber auch hier Fehlanzeige. Er stürmt wieder munter voran, lässt seinem Ungestüm freien Lauf, seinem Jähzorn sowieso und so kommt es, dass die wirklich perfekte Gelegenheit wieder an ihm vorbeizieht.
Ein kleines Männlein kommt aus der Hölle (nein, nicht Isnogud) und muss voller Verwunderung feststellen, dass der Großwesir immer noch Unterwürfigkeit heuchelt. Zwar strengt sich Isnogud immer noch hartnäckig an, sein Ziel zu erreichen (Kalif werden anstelle des Kalifen), aber irgendwie mangelt es an der dazu nötigen Portion Glück. Glück sollte der Großwesir denn auch wenigstens an seinem Geburtstag haben: Aber auch hier Fehlanzeige. Er stürmt wieder munter voran, lässt seinem Ungestüm freien Lauf, seinem Jähzorn sowieso und so kommt es, dass die wirklich perfekte Gelegenheit wieder an ihm vorbeizieht.
Der Teufel soll ihn holen! So ungefähr könnten es all jene gedacht haben, die Isnogud, der Großwesir, in den ganzen Jahren bei der Jagd auf die Position des Kalifen immer wieder gepiesackt hat. Aber: Der Teufel will Isnogud noch nicht holen, denn Isnoguds Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Noch einmal aber: Der Teufel ist nicht amüsiert, denn die Aufgabe sollte längst zur Zufriedenheit aller, vor allem der des Teufels, erledigt sein. Also wird Isnogud einbestellt.
Interessanterweise erhält der Leser hier einen Einblick in einen kleinen Abschnitt Comic-Geschichte. Jean Tabary verwendete ursprünglich Adolf Hitler für einen kleinen Höllenauftritt. Für die deutsche Ausgabe setzte sich Tabary noch einmal an den Zeichentisch und setzte an die Stelle des Diktators Rodrigo Borgia ein, der für seine Praktiken einen berüchtigten Platz in der Historie einnimmt. In der vorliegenden Ausgabe können nun beide Seitenversionen, jeweils gegenüberliegend miteinander verglichen werden.
Sieht man von dieser Unregelmäßigkeit ab, hat Tabary in der ersten Geschichte über den Großwesir namens Isnoguds Komplize ein Verwirrspiel in bester französischer Komödientradition geschaffen. Beliebtes Mittel für den Spaß ist die Verwechslung ebenso wie der Running Gag (obwohl die ganze Reihe ein solcher ist, schließlich wird das glorreiche Ziel des Großwesirs nie erreicht). Die Fee Ole, ein begnadeter Fassadenmaler und Bildhauer sowie ein blinzelnder Arzt tragen zum verschachtelten und stets schneller vorangetriebenen Handlungsverlauf bei.
Wie kann es anders sein: Isnogud ist natürlich wieder nicht Kalif geworden. Trotz teuflischer Hilfe. An Isnoguds Geburtstag soll eine Zauberschachtel Abhilfe schaffen. Isnoguds ungestümer Charakter stellt dem ehrgeizigen Großwesir ein Bein, so dass nach einer neuen Lösung gesucht werden muss. Geduld lautet das Zauberwort. Diese besitzt Isnogud zwar, zieht man seinen endlosen Ehrgeiz und die unzähligen Anläufe auf die Kalifenstelle in Betracht. Darüber hinaus fehlt es aber weitgehend daran. Eine Zauberschachtel entpuppt sich so als Endlosvariante einer russischen Matroschka, nur mit Geschenken. Daraus wird ein einziges Chaos.
Überhaupt nicht chaotisch sind Tabarys Bilder, meist vierreihig pro Seite angelegt. Hier geht es Schlag auf Schlag. Neben Gags, die Reihe auf Reihe folgen, manchmal Bild für Bild, werden ganz nebenbei noch längerfristige Pointen vorbereitet. In schmissigen Strichen, ungeheuer versiert nach derart vielen Abenteuern und Einseitern entsteht in den hier vorliegenden drei Alben. Die Nervenkrisen von Isnogud, die Sammlung der Einseiter mit den Texten von Buhler. schwächelt hier und da gegenüber den beiden Vorgängergeschichten, ein paar Glanzlichter sind aber auch hier zu finden.
Ein Spaß, ein Dauerbrenner, der nicht umsonst derart lange im Comic-Universum überleben konnte. Die Mixtur stimmt weiterhin, da Goscinnys Texternachfolger Jean Tabary die Ideen über die Jahre nicht ausgegangen sind und er das Konzept konsequent fortführte. War gut, bleibt gut. 🙂
Die gesammelten Abenteuer des Großwesirs Isnogud, Buch 7: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 06. April 2010
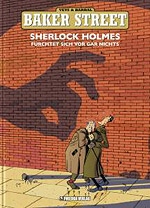 Mrs. Hudson kocht so, wie sie es gelernt hat. Deftig. Mit Gedärm. Solange Holmes und Watson nicht wissen, was auf dem Teller liegt, ging alles gut. Jedenfalls bis zu jenem schicksalhaften Tag, als Mrs. Hudson unbedingt mit der Wahrheit herauskommen musste. Aber was sind schon Mrs. Hudsons Kochkünste gegen einen zünftigen Kriminalfall. Sherlock Holmes und sein Partner Dr. Watson müssen nicht lange warten, bis Inspektor Lestrade sich mit einer neuen Aufgabe einstellt. Zwar bemühen sich beide, dem nervigen Inspektor nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, doch Holmes besondere Intelligenz wird vermutlich nur durch Lestrades Hartnäckigkeit übertroffen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Sherlock Holmes ermittelt … und liegt komplett falsch.
Mrs. Hudson kocht so, wie sie es gelernt hat. Deftig. Mit Gedärm. Solange Holmes und Watson nicht wissen, was auf dem Teller liegt, ging alles gut. Jedenfalls bis zu jenem schicksalhaften Tag, als Mrs. Hudson unbedingt mit der Wahrheit herauskommen musste. Aber was sind schon Mrs. Hudsons Kochkünste gegen einen zünftigen Kriminalfall. Sherlock Holmes und sein Partner Dr. Watson müssen nicht lange warten, bis Inspektor Lestrade sich mit einer neuen Aufgabe einstellt. Zwar bemühen sich beide, dem nervigen Inspektor nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, doch Holmes besondere Intelligenz wird vermutlich nur durch Lestrades Hartnäckigkeit übertroffen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Sherlock Holmes ermittelt … und liegt komplett falsch.
Sherlock Holmes und Doktor Watson waren ein Traumduo der Kriminalgeschichte lange bevor Namen wie Hans Albers und Heinz Rühmann oder Robert Downey Jr. und Jude Law in die Rollen der passionierten Verbrecherjäger schlüpften. Nun haben sich vor rund 10 Jahren der Autor Pierre Veys und der Zeichner Nicolas Barral zusammengetan und die wirkliche Geschichte über das Wirken und Zusammenleben der beiden Ausnahmekriminologen zu erzählen. Herausgekommen ist ein Blick auf einen Detektiv, der weniger ist, als er zu sein scheint. Der um sieben Ecken denkt, wenn die Lösung gleich vor seiner Nase sitzt. Und hin und wieder von seinem immer wieder gedemütigtem Partner Dr. Watson übertrumpft wird.
Operetten-Detektiv! Die verschiedenen Geschichten im vorliegenden ersten Band der Baker Street Reihe werden zu einem großen Ganzen voller Humor und Anspielungen. Man versteht den Humor auch ohne die Geschichten des Originals gelesen zu haben, aber es ist eindeutig besser, sich ein wenig in der Welt des Sherlock Holmes auszukennen. Holmes weiß in den originalen Erzählungen sehr viel. Seine Aufklärungstechniken beruhen auf einem enormen Allgemeinwissen und einer Reihe von Experimenten und eigens erstellten Wissenssammlungen. Pierre Veys treibt dieses Wissen auf die Spitze. Es ist zu jeder Zeit abrufbar, es werden quer gegen jede Vernunft und Wahrscheinlichkeit Fälle rekonstruiert, die zwar spannend klingen, aber so nicht stattgefunden haben.
Holmes, in den Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle zeitweilig aus Langeweile dem Kokain und Morphium zugetan, hat hier seinen geschätzten Watson durch seine gehässige und herablassende Art in den Suff getrieben. Dennoch: Einen gibt es, an dem Holmes zu scheitern droht, an dem sein enormes Ego zerbricht. Professor Moriarty. Dort, wo Pierre Veyes all diese Zutaten genüsslich, intelligent und urkomisch vermischt, setzt Nicolas Barral mit seinen Zeichenkünsten an und treibt die Szenerie auf die Spitze.
Nicolas Barral, Comic-Fans hierzulande auch durch die Geschichte um Philip und Francis bekannt (ebenfalls im Team mit Veyes), beherrscht den Funny-Strich exzellent. Zart, zerbrechlich, wie es sich oft bei den Großen dieser Stilrichtung findet entstehen hier komödiantische Szenen, in denen es auch abseits der eigentlichen Handlung einiges zu entdecken gibt. England, so scheint es aus der Sicht des Festlandes, ist ein Flecken für ein sehr skurriles Völkchen mit seltsamen Gewohnheiten und merkwürdigem Aussehen. Wenigstens was ersteres anbelangt, hat schon Sir Arthur Conan Doyle eifrig davon Gebrauch gemacht.
Very british: Sehr viel Humor, auch durchaus mal schwarz. Pierre Veyes und Nicolas Barral rütteln am Detektivdenkmal Sherlock Holmes. Dieser selbst gestellten Aufgabe kommen sie mit Fingerspitzengefühl, dem besten Sinn für Pointen und Karikaturen nach. Ganz prima, auch, aber nicht nur für Fans von Sherlock Holmes. 🙂
Baker Street 1, Sherlock Holmes fürchtet sich vor gar nichts: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 16. März 2010
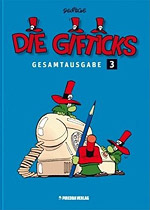 Der Roboter, einarmig oder nicht, verrichtet seinen Dienst. Endlich einmal so groß sein wie andere! Die Gifticks, die an den Steuerelementen des Roboters sitzen, lassen sich von ihm nicht nur durch die Landschaft tragen. Tatsächlich lässt sich solch eine mechanische Imitation eines Menschen auch gut dazu nutzen, ein wenig Schabernack zu treiben. Allerdings lässt sich die Gendarmerie nicht so leicht ins Bockshorn jagen wie harmlose Autofahrer. Bald befinden sich die Gifticks auf der Flucht. In einem alten Schloss finden sie Unterschlupf. Zwischen den noch älteren Rüstungen könnten sie nicht weiter auffallen, wäre da nicht der Graf, der Besitzer des Schlosses, der sich auch gegen eine unbekannte Bedrohung zu verteidigen weiß. Wenn nötig mit einem sehr großen Kaliber von ziemlicher Durchschlagskraft.
Der Roboter, einarmig oder nicht, verrichtet seinen Dienst. Endlich einmal so groß sein wie andere! Die Gifticks, die an den Steuerelementen des Roboters sitzen, lassen sich von ihm nicht nur durch die Landschaft tragen. Tatsächlich lässt sich solch eine mechanische Imitation eines Menschen auch gut dazu nutzen, ein wenig Schabernack zu treiben. Allerdings lässt sich die Gendarmerie nicht so leicht ins Bockshorn jagen wie harmlose Autofahrer. Bald befinden sich die Gifticks auf der Flucht. In einem alten Schloss finden sie Unterschlupf. Zwischen den noch älteren Rüstungen könnten sie nicht weiter auffallen, wäre da nicht der Graf, der Besitzer des Schlosses, der sich auch gegen eine unbekannte Bedrohung zu verteidigen weiß. Wenn nötig mit einem sehr großen Kaliber von ziemlicher Durchschlagskraft.
2005 wurde das letzte Interview mit Paul Deliege geführt, dem Autor und Zeichner der Gifticks. Einige Aussagen von Deliege sind interessant, andere sogar erstaunlich. Seine Erfahrungen sind vom Alltag eines Comicmachers geprägt, der über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung auf dem Markt verfolgt hat. Innerhalb weniger Aussagen räumt Deliege mit jeglicher romantischer Vorstellung dieses Berufes auf. Comic-Magazine und Comic-Verlage wollen Geld verdienen. Entsprechend hat ein Autor und Zeichner seine Arbeit zu machen. Paul Deliege hat lange durchgehalten, hat sich aber auch in diesem harten Geschäft, das so sehr vom Geschmack der Leser abhängt, seine Bewunderung für die Großen im Comic-Bereich bewahrt.
Der Mann, der den kleinen Ausbrecher Bobo betreute, kann nach eigener Aussage mit den Gifticks nicht sehr viel anfangen. Seine Argumente sind teilweise nicht von der Hand zu weisen, aber das die Gifticks selbst nicht witzig sind, stimmt ganz bestimmt nicht. Gerade mit der vorliegenden dritten und letzten Gesamtausgabe wird gezeigt, welches komödiantisches Talent die drei Giftzwerge haben.
Die Gifticks haben Augen, eine Nase, aber keinen Mund. Nicht einmal ihr Gesicht ist zu sehen. Aber sie sprechen. Gott sei Dank, tun sie das. Mehr noch, die agieren auch wie Komödianten. Gifticks sind komisch, weil sie es eigentlich nicht sein wollen. Im vorliegenden Fall treffen sie auf einen Grafen, der in den kleinen Wichten, die immer noch die Herren der Welt werden wollen, eine willkommene Gelegenheit sieht, um an sein Erbe zu gelangen. Nahtlos schließt Paul Deliege mit Das alte Schloss an die vorhergehende Geschichte an. Die Gifticks, die sich an ihren komfortablen (wenn auch einarmigen) Roboter zur Fortbewegung gewöhnt haben, geraten an einen mehrere Schießwütige. Aber nur einer hat letztlich Erfolg: der Graf von Weizenbier.
Damit beginnt (ob Paul Deliege will oder nicht) eine aberwitzige Komödie, die auch mit der zweiten Geschichte Die Erbschaft fortgeführt wird. Der Graf, von Deliege als menschlicher Geier entworfen (aus dem ein gemeines Küken wird), wird zu einer gelungenen Slapstick-Figur, immer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mit schmalem Körper, großem Kopf kreiert Deliege seine Figur fast schon wie eine Karikatur und mit deutlich mehr Individualität als andere Charaktere (Polizisten, Diener), denen nur kurze Auftritte beschert sind. Der andere Erbe wirkt etwas liebloser gezeichnet, ebenso die Katze. Beide könnten aus sehr modernen Funnys stammen, Witzseiten von Magazinen oder Tageszeitungen.
Die Gifticks hingegen, ob nun von ihrem Schöpfer ein wenig geschmäht oder nicht, sind treffliche Entwürfe, die einfach in diesen Geschichten funktionieren. Vier Seiten einer unvollendeten Geschichte, die zusammen mit dem Interview und vielen Skizzen im Anhang zu finden sind, zeigen auch, wie gut die Gifticks in Schwarzweiß funktionieren. Die Linienführung und die Schattierungen geben ein Beispiel, dass Paul Deliege weitaus mehr auf dem Kasten hatte, als er angesichts des Interviews von sich glauben mag.
Ein Spaß: Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein guter Spaß ist nicht leicht zu schreiben und zu zeichnen. Paul Deliege gelingt dieses Kunststück auf der ganzen Linie. Wunderbar. 🙂
Die Gifticks Gesamtausgabe 3: Bei Amazon bestellen
Oh, ich sehe gerade: 1100 Einträge von mir! Mann, Mann, Mann, wie die Zeit vergeht.
Samstag, 06. März 2010
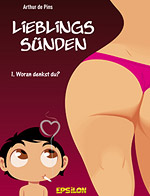 Da guckt doch einer! Irgend so ein kleiner Perversling schaut den jungen Frauen doch glatt dabei zu, wie sie in ihrem Aerobic-Kurs ihre Kurven straffen. Das jedenfalls glaubt die Aerobic-Trainerin, die Arthur, den vermeintlichen Lustmolch, zur Rede stellt. Aber: Wollen die jungen Frauen nicht in Wahrheit, dass sich die Männer nach ihnen umsehen? Wollen sie nicht ausgerechnet für solche Männeraugen sexy sein? Quälen sie sich nicht genau für solch kleinen Momente ab, die das Ego straffen?
Da guckt doch einer! Irgend so ein kleiner Perversling schaut den jungen Frauen doch glatt dabei zu, wie sie in ihrem Aerobic-Kurs ihre Kurven straffen. Das jedenfalls glaubt die Aerobic-Trainerin, die Arthur, den vermeintlichen Lustmolch, zur Rede stellt. Aber: Wollen die jungen Frauen nicht in Wahrheit, dass sich die Männer nach ihnen umsehen? Wollen sie nicht ausgerechnet für solche Männeraugen sexy sein? Quälen sie sich nicht genau für solch kleinen Momente ab, die das Ego straffen?
Die jungen Damen sind nicht die einzigen im Leibesreigen, die sich hier die eine oder andere Frage stellen. Nichts ist sicher. Es gibt einfach kein Geheimrezept. Deshalb kommt es immer wieder zu Verirrungen und Verwirrungen, ganz im Sinne des Lesers, denn Arthur de Pins greift mit seinen Sketchen ins moderne pralle Leben.
Arthur ist ein Paradebeispiel eines jungen Mannes, in der Blüte seines Lebens stehend und verwirrt über all das, was frau von ihm will, und all das, was er von den Frauen will. Autor und Zeichner Arthur de Pins hat sich einem Thema angenommen, stets gleichbleibend aktuell: Männer und Frauen. Ähnlich liebenswert, auch frivol wie es beliebte Filmkomödien wie Keinohrhasen und Zweiohrküken darstellen, nähert sich De Pins dem schwierigen Balanceakt (mit der Betonung auf Akt) an, dem mann sich meistens ausgesetzt sieht, will er beim weiblichen Geschlecht landen. Man könnte unter dem Strich auch sagen: Sex and the city aus männlicher Sicht. Andererseits gibt De Pins glasklar zu verstehen: Frau hat es auch nicht leicht.
Alles beginnt damit, dass Arthur eine Freundin namens Cecille hat. Die Beziehung ist nagelneu, Arthur freut sich und, wie kann es anders sein, natürlich haben all seine Freunde Ratschläge parat, wie ein Mann in eine neue Beziehung gehen sollte. Am Ende ist Arthur nur noch ein zitterndes Häufchen Elend. Aus Angst, das Falsche zu tun, unternimmt er gar nichts und verharrt wie das sprichwörtlich hypnotisierte Kaninchen in zusammengeballter Starre. Logisch, dass seine neue Freundin Cecille gerade dieses Verhalten sehr befremdlich findet.
Arthur de Pins entwirft ein Beziehungsgeflecht von Mann und Frau in vielen Einseitern, schafft es aber auch, den Kern eines Themas innerhalb eines Bildes zu treffen. Das geht öfter mal humorvoll unter die Gürtellinie (das bleibt nicht aus, wenn es auch um Sex geht), besitzt aber jedesmal einen gewissen Charme, der an französische Komödien erinnert. Ein bestimmter kleiner Scherz (ein Selbstmörder, der keiner ist) erinnert so auch an einen Klassiker wie Ein Elefant irrt sich gewaltig.
Wie auch immer jemand (hier der Leser) den Humor finden mag, ob er (für sie auch geeignet) sich damit anfreunden kann oder nicht, Arthur de Pins hat seine Figuren so gestaltet, dass niemand ihnen böse sein kann. Ihre Köpfe sind schon rund, besitzen große Augen, einen kleinen bis großen Mund (je nach Gefühlslage) und keine Nase. Proportional zum restlichen Körper ist der Kopf wenigstens halb, manchmal sogar ebenso groß. Das ergibt einen richtigen Knuddel-Look.
Gleich auf der ersten Seite, unter dem Titel, wird deutlich, wie Arthur de Pins seine Figuren gestaltet. Herkömmlich vorgezeichnet per Bleistift, setzt De Pins die stets sehr runden Formen mittels Vektorgrafiken um. So entsteht für Stück aus scherenschnittartigen Gebilden eine kleine Figur, deren einzelne Bestandteile auch für spätere Produktionen passgenau bearbeitet werden können. Mit Außenlinien hält sich De Pins hier nicht auf. Die brauchen seine Figuren dank der knackigen Formen auch nicht. Knackig (im Sinne von knackig wie ein praller Apfel) ist hier wörtlich zu nehmen, da De Pins tatsächlich eines seiner weiblichen Figürchen präsentiert, dem ein Stück aus dem Po gebissen wurde.
In sehr feinen, aber wenigen Farbabstufungen werden die puppenähnlichen Figuren schattiert und in ihre Umgebung integriert. Ein mitunter quietschebuntes, aber stets sehr gut aufeinander abgestimmtes Vergnügen.
Eine sehr schöne Episodensammlung aus dem Erleben paarungsbereiter Großstädter. Überall gibt es etwas zu entdecken und auch falsch zu machen. Aus Fettnäpfchen und Lernprozessen entsteht hier ein liebevoller Humor. Als Ergebnis ist für den Leser vom Schmunzler bis zum Brüller alles dabei. 🙂
Lieblingssünden 1, Woran denkst du: Bei Amazon bestellen
Leseprobe unter mycomics.de
Samstag, 20. Februar 2010
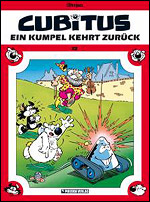 Rache! Die kleinen Roboter haben ihn angegriffen! Na, gut, so schlimm wäre das nicht. Aber hier geht es um Fleisch. Frisches, neues und saftiges Fleisch, gerade beim Metzger erstanden. Und nun liegt es auf der Straße, platt gefahren, vernichtet, unbrauchbar … Und alles nur wegen dieser gemeinen … Cubitus ist ratlos. Im Notfall: Glas einschlagen. Ein kleiner Hinweis nur bringt Cubitus auf eine Idee. Vielleicht nicht die beste Idee, aber immerhin eine Idee. Ohne in Betracht zu ziehen, welche Ereignisse er damit in Gang setzen wird.
Rache! Die kleinen Roboter haben ihn angegriffen! Na, gut, so schlimm wäre das nicht. Aber hier geht es um Fleisch. Frisches, neues und saftiges Fleisch, gerade beim Metzger erstanden. Und nun liegt es auf der Straße, platt gefahren, vernichtet, unbrauchbar … Und alles nur wegen dieser gemeinen … Cubitus ist ratlos. Im Notfall: Glas einschlagen. Ein kleiner Hinweis nur bringt Cubitus auf eine Idee. Vielleicht nicht die beste Idee, aber immerhin eine Idee. Ohne in Betracht zu ziehen, welche Ereignisse er damit in Gang setzen wird.
Ein Kumpel kehrt zurück! Und was für einer! Dupa, Autor und Zeichner, zeigt hier wie wenig es bedarf, um eine putzige, knuffige und die Geschichte vorantreibende Figur zu schaffen. Ein Kumpel namens Viktor hatte bereits in Band 8 seinen Auftritt. Der chaotische kleine Roboter verbrachte seine Zeit seither unter einer Glasglocke. Aber warum wird er wieder hervorgeholt?
Stein des Anstoßes ist ein anderer, genauer gesagt, zwei andere Roboter. Rocky Star und Raupe können, in den falschen Händen, schon mehr als nur den letzten Nerv rauben. Und wie kann es anders sein? Sie sind in den falschen Händen!
Dupa erzählt diesmal eine albumlange Geschichte, in der ein Ereignis das nächste jagt. Wie der sprichwörtliche Dominoeffekt entsteht durch Aktion eine Reaktion und so weiter und so fort. Durch den geschickten Einsatz verschiedener Nebenfiguren (die kleinen Roboter wollen auch gesteuert werden), die mal Täter mal Opfer sind (ein Mädchen wird von den Robotern angebaggert und ersinnt einen Racheplan), entsteht eine immer komplexer werdende Geschichte.
Deshalb muss der Leser noch lange nicht auf schnell aufeinander folgende Gags verzichten. Diese erfolgen immer noch mindestens im Seitentakt (wenn nicht öfter), aber Dupa hat so die Gelegenheit Running-Gags zu etablieren und längerfristig Pointen vorzubereiten. Einer dieser Running-Gags wird gleich auf Seite 1 eingeführt: Steuern! Es gibt Worte, die unter den Menschen Angst verbreiten. Cubitus, den diese Erkenntnis unverhofft trifft, verwendet diese sofort auf der zweiten Seite wieder, um die Wirksamkeit zu testen. Doch das ist nur der Auftakt. Sehr bald schon schlägt die Geschichte die Erzählrichtung um den Kumpel ein. Dupa verwendet dazu eine kapitelweise Einteilung, ohne diese konkret zu bezeichnen.
In dieser Geschichte müssen alle wichtigen Charaktere ran. Neben Cubitus und Boje darf auch Paustian mit an einem Strang ziehen. Cubitus, herzerfrischend knuddelig von Dupa gezeichnet, wird einiges abverlangt. Er läuft, hetzt, fliegt durch die Luft, rollt, wird gestoßen, geschleudert … Kurzum, hier purzelt der Hund. Der Leser darf sich davon überzeugen, dass der weiße Knuddelhund auch Taschen in seinem Fell hat. Paustian hingegen beweist, dass er echte Duo-Qualitäten besitzt und weit mehr ist als nur der ewige Sidekick (im wahrsten Sinne des Wortes). Ganz nebenbei wird die Frage geklärt, warum Cubitus eigentlich Cubitus heißt.
Ein ganzes Album lang erlebt Cubitus ein außergewöhnliches Abenteuer mit seinen Freunden (und belebt einen alten Kumpel). Das ist Chaos, Situationskomik, in bester Cartoon-Manier gezeichnet mit einer liebenswerten Hauptfigur. Dupa in Höchstform! 🙂
Cubitus 22, Ein Kumpel kehrt zurück: Bei Amazon bestellen
Freitag, 05. Februar 2010
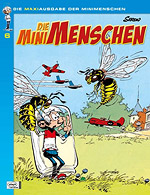 Folter: Man nehme einen Schwamm und befeuchte die Füße mit Wasser. Danach werden die Füße kräftig mit Salz eingestäubt. Anschließend … darf die Ziege ans Werk. Zwischen Kreischen und Wiehern hallen die Lacher des gefesselten Renauds durch die Burg. Wer hätte das gedacht? Es sollte ein schöner Ausflug werden. Eine alte Ruine lädt zum Besichtigen und zum Verweilen ein. Plötzlich: Pfeile schwirren durch die Luft. Sie zielen auf Renaud und seinen Freund Lapoutre. Mehr noch: Die Pfeile sind auf die Dimensionen der Minimenschen abgestimmt. Was ist hier los? Als die beiden Wanderer eine Burg in der Burg entdecken, ahnen sie, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Folter: Man nehme einen Schwamm und befeuchte die Füße mit Wasser. Danach werden die Füße kräftig mit Salz eingestäubt. Anschließend … darf die Ziege ans Werk. Zwischen Kreischen und Wiehern hallen die Lacher des gefesselten Renauds durch die Burg. Wer hätte das gedacht? Es sollte ein schöner Ausflug werden. Eine alte Ruine lädt zum Besichtigen und zum Verweilen ein. Plötzlich: Pfeile schwirren durch die Luft. Sie zielen auf Renaud und seinen Freund Lapoutre. Mehr noch: Die Pfeile sind auf die Dimensionen der Minimenschen abgestimmt. Was ist hier los? Als die beiden Wanderer eine Burg in der Burg entdecken, ahnen sie, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Sie sind nicht allein! Die Minimenschen haben bereits festgestellt, dass sie nicht die einzigen Winzlinge auf dem Planeten sind. Auch ein außerplanetarischer Gesteinsbrocken war bereits der sprichwörtliche Stein des Anstoßes der Verwandlung anderer Minis. Inzwischen ist es auch klar, dass die uns bekannten Minimenschen nicht die ersten Kleinen gewesen sind. Allerdings sind sie die findigsten Winzlinge. Pierre Seron, hauptsächlich verantwortlich für die hier versammelten Abenteuer und nur selten unterstützt durch Mittei, erweckt Minis aus der Vergangenheit und aus fernster futuristischer Vergangenheit. Hört sich seltsam an, ist aber so. Mehr noch: Die Minis werden kriminell.
Verbrechen waren schon häufiger ein Thema in der Welt der Minimenschen und drumherum in der Welt der Großen. Doch eine kriminelle Zusammenarbeit zwischen Klein und Groß ist neu. Die Idee ist einfach, aber prägnant. Es steht die Frage im Raum, warum Seron erst zu diesem Zeitpunkt mit einer solchen Geschichte kam. Flugzeuge, sehr kleine natürlich, greifen Geldtransporter an. Da steht die Spannung im Vordergrund, der Humor dient zur Auflockerung. Eine dritte nicht unwichtige Zutat ist der Einfallsreichtum der Handlung.
Viele tolle Ideen machen aus der vorliegenden Ausgabe etwas Besonderes innerhalb der Minimenschen-Reihe. Bevor es an die Aufklärung von Raubüberfällen und den Diebstahl von Flugzeugen geht, haben die Minimenschen eine Begegnung mit dem Mittelalter. Das ist deutlich lustiger, auch chaotischer. Nach einer kürzeren Bekanntmachungsgeschichte geht es in ein längeres Abenteuer, das in einer richtigen Schlacht gipfelt, Lacher inklusive. Denn natürlich leben auch die kleinen Ritter in Burgen, die so klein sind, dass sie bequem in einer Ecke einer echten alten Burgruine Platz haben.
Die Gefangenen der Zeit lautet der Titel des abschließenden Abenteuers in dieser Ausgabe. Als hätten die phantasievollen Theorien um hoch entwickelte Völker, die vor Äonen auf der Erde lebten, Pate gestanden, so schickt Seron seine winzigen Helden in einen Abschnitt der Welt, der auch ein Zuhause für einen Zyklotrop hätte sein können. Die Jagd auf einen Verbrecher führt in eine wundersame Welt. Zuerst kann der Genre-Freund den Eindruck gewinnen, es mit einer Art von Vergessenen Welt zu tun zu haben. Wenig später finden sich ein paar letzte Überlebende, wild gewordene Steinzeitmenschen … Es ist schlicht und ergreifend ein großer Spaß, bei dem kein Auge trocken bleibt.
Grafisch darf Seron wieder mit allerhand Fluggerät aufwarten. Allerdings ist auch der Rest der Kulissen eine sehr feine Angelegenheit. Seron versteht es, für seine Figuren die perfekte Bühne zu bereiten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Gleichzeitig wird so ersichtlich, welche Vielfalt die Reihe insgesamt bereithält. Aus einer kleinen Wanderung wird ein anfänglich gruseliges Abenteuer vor mittelalterlicher Kulisse. Die alten Rittersleut sind treffsicher in Szene gesetzt: Knubbelnasen, rundlich, eher freundlich als bedrohlich. Letzteres ist ein grundsätzliches Vorgehen.
Gerade im letzten Abenteuer, in der sich urzeitliche Gorillamännchen anschicken, einen Angriff auf die letzten verbliebenen Männer eines untergangenen Volkes zu starten, kann Seron durch sein putziges Design überzeugen. Wenn dann noch ein Triceratops mit einem Pflaster auf der Wange an Renaud vorüber läuft und eine Anakonda sich Hals über Kopf in den Minimann verknallt, dann wirken die Bilder bereits ohne Worte.
Ein Spaßfeuerwerk von der ersten bis zur letzten Seite: Die Minimenschen in Bestform. Klasse! 🙂
Die Maxiausgabe der Minimenschen 6: Bei Amazon bestellen
Freitag, 22. Januar 2010
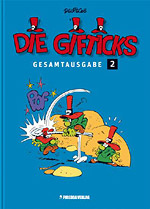 Die Gifticks haben ein Problem. Sie sind klein, aber sie haben trotzdem Hunger. Das Dumme ist: Die vielen Speisen der Menschen sind oft so aufwändig verpackt, so dass ein Giftick nur sehr schwer an den Inhalt herankommt. So wie bei dieser Dose mit Sardinen. Ohne Öffner geht hier gar nicht nichts. Doch woher soll dieser Öffner genommen werden. Während zwei Gifticks sich auf den Weg machen, um einen zu finden (oder auch Nahrung, deren Verpackung keinen Kraftakt benötigt), bleibt die Nummer Drei genervt zurück. Gifticks sind findig. Deshalb gelingt es zweien tatsächlich einen Dosenöffner aufzutreiben. Leider sind Gifticks nicht unbedingt geduldig, weshalb …
Die Gifticks haben ein Problem. Sie sind klein, aber sie haben trotzdem Hunger. Das Dumme ist: Die vielen Speisen der Menschen sind oft so aufwändig verpackt, so dass ein Giftick nur sehr schwer an den Inhalt herankommt. So wie bei dieser Dose mit Sardinen. Ohne Öffner geht hier gar nicht nichts. Doch woher soll dieser Öffner genommen werden. Während zwei Gifticks sich auf den Weg machen, um einen zu finden (oder auch Nahrung, deren Verpackung keinen Kraftakt benötigt), bleibt die Nummer Drei genervt zurück. Gifticks sind findig. Deshalb gelingt es zweien tatsächlich einen Dosenöffner aufzutreiben. Leider sind Gifticks nicht unbedingt geduldig, weshalb …
Damit sind weitere Verwicklungen vorprogrammiert. Die Gifticks, die es nicht nur gewohnt sind, anderen Kummer zu bereiten, bleiben auch selbst nicht davon verschont. So wird aus der simplen Beschaffung eines Dosenöffners (sofern man von simpel sprechen kann, wenn man gerade einmal so groß ist, dass ein Bad in einer Sardinendose denkbar wäre) zu einem halsbrecherischem Abenteuer.
Und es soll nicht das einzige bleiben: Gifticks haben einen Wunsch. Sie möchten gerne die Weltherrschaft übernehmen. Und sie haben ein Problem. Sie sind gerade einmal so groß, dass es möglich wäre, in einer Sardinendose zu … Aber das schrieb ich schon. So ein Giftick hat aber noch ein Problem. Seine Größe bringt es mit sich, dass ihm wirklich ständig etwas zustoßen kann. Daher käme ein gutes Versteck gerade zur rechten Zeit. Ein Haus, das von anderen für ein Spukhaus gehalten wird, könnte das richtige sein. Leider … Ja, leider sind Gifticks auch Pechvögel. Also, leider sind sie nicht die einzigen auf dieser Welt, die nach einer globalen Herrschaft streben.
In der zweiten Folge der Gesamtausgabe der Gifticks geht es deutlich humorvoller zu als zuvor. Die Gifticks waren ihrer Zeit weit voraus. Ihr Ziel, die Weltherrschaft zu erlangen, ist dafür bezeichnend. 1977 stellte ihnen ihr Schöpfer Paul Deliege sogar Konkurrenz zur Seite. Und selbst die war ihrer Zeit weit voraus. (Erst 1993 sollten Mäuse wie Pinky und Brain dieses Ziel auf dem Fernsehschirm verfolgen.) Doch zurück auf Anfang.
Die Zeichnungen sind verspielter, viel stärker funny als bisher. Der Gegensatz, die Figuren der Gifticks zu ihrer Umgebung und anderen handelnden Personen, ist nun fort. Die Welt der Gifticks ist komplett cartoony. Beides, das ursprüngliche Konzept wie auch die hier vorliegende Umsetzung, hat seinen Reiz. Unter dem Strich allerdings lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass die Gifticks zu diesem Zeitpunkt in der fantasievollen Komödie angekommen. Derart fantasievoll sogar, es keine Grenze mehr gibt.
Waren die Gifticks ursprünglich die Angreifer, die bösen Buben, rutschen sie hier in die Opferrolle und gehören zu denjenigen, die in die Bredouille geraten. Die Menschen sind hier vollends zu Nebenrollen geraten. Sie sind die Statisten, über die man lacht, wie es sich für eine französische Komödie gehört. In der albenlangen Episode Das seltsame Haus werden sie eigentlich noch nicht einmal mehr benötigt.
Der Zeichenstil ist sehr 70er und somit auf der Höhe der damaligen Zeit, wie ihn der Leser häufig in europäischen Comic-Magazinen fand. Vergleicht man ihn mit Cartoons der Gegenwart, findet sich vieles wieder. Was gut ist, bleibt eben gut. Manches, so wie die stilistische Grundtendenz der Zeichnungen von Paul Deliege lässt sich eben nicht besser machen. In Abenteuerliche Entführung sind die Zeichnungen sehr sorgfältig getuscht, in der folgenden Episode gestattet sich Deliege etwas mehr Schmiss, ohne die Sorgfalt vermissen zu lassen. Vergleichsweise könnte man sagen: Hat zuerst noch der Techniker die Oberhand, übernimmt daraufhin der Künstler die Führung.
Nachdem die Gifticks vorgestellt sind, werden sie nun auch zu Sympathiefiguren, die einem sogar leid tun können. Wer hätte das gedacht? Aber diese Erzählrichtung ist sehr lustig und glänzt mit immer neuen Einfällen. Wer kleine aberwitzige Wichte mit besonderen Fähigkeiten erleben möchte, die toll in eine schöne und abenteuerliche Komödie eingebunden sind, sollte einen Blick in diese Ausgabe der Gifticks riskieren. 🙂
Die Gifticks Gesamtausgabe 2: Bei Amazon bestellen
Freitag, 01. Januar 2010
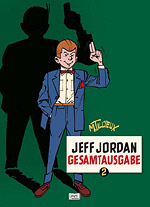 Die Kuh ist nicht das größte Ärgernis, obwohl sie alles frisst, was grün und nicht angenagelt ist. Ein Geist geht um in den Ruinen, weiß, gruselig, leise. Leider auch mit einem Hang zum Schnupfen. Kein Wunder bei diesem Wetter, bei dem noch nicht einmal ein Hund vor die Tür geschickt wird. Jeff Jordan nimmt sich des ungewöhnlichen Falles an. Ausgerüstet mit einer Infrarotkamera macht er Jagd auf den Unheimlichen, nur um am Ende nicht dem Geist, sondern einem roten Mönchen gegenüberzustehen, der nicht minder geheimnisvoll, dafür aber umso schlagkräftiger ist und Jordan erst einmal bewusstlos zurücklässt.
Die Kuh ist nicht das größte Ärgernis, obwohl sie alles frisst, was grün und nicht angenagelt ist. Ein Geist geht um in den Ruinen, weiß, gruselig, leise. Leider auch mit einem Hang zum Schnupfen. Kein Wunder bei diesem Wetter, bei dem noch nicht einmal ein Hund vor die Tür geschickt wird. Jeff Jordan nimmt sich des ungewöhnlichen Falles an. Ausgerüstet mit einer Infrarotkamera macht er Jagd auf den Unheimlichen, nur um am Ende nicht dem Geist, sondern einem roten Mönchen gegenüberzustehen, der nicht minder geheimnisvoll, dafür aber umso schlagkräftiger ist und Jordan erst einmal bewusstlos zurücklässt.
Durch die Hölle von Massacara heißt es gleich zu Beginn der 2. Gesamtausgabe der Jeff Jordan Klassiker. Ein kleiner Staat in Südamerika, mit großen Anteilen einer riesigen Wüste und der Melone als Hauptnahrungsmittel, hat es sich vorgenommen, seine Macht zu vergrößern: Natürlich mit Waffen. Ein Erfinder wurde entführt. Jeff Jordan reist mit seinem Assistenten Teddy geradewegs in die Höhle des Löwen, um den Mann zu retten.
Maurice Tillieux hat seine Hausaufgaben gemacht. Ab einem gewissen Punkt lässt sich nicht mehr sagen, wer Vorreiter, Wegbereiter oder Nachahmer ist. Fakt ist allerdings, dass diktatorische Regime ein gern gesehenes Zielobjekt von lustigen Geschichten und Cartoons sind. Da nehmen sich Spirou und Fantasio ebenso wenig aus wie in gewisser Weise auch ein Isnogud. In diesem beschriebenen Land mit seiner leicht trotteligen Geheimpolizei mag einiges drunter und drüber gehen, in Sachen Gefängnis sind sie beinahe so professionell wie ein echtes Regime. Ein Gefängnis inmitten einer hunderte von Kilometern staubtrockenen Wüste braucht keine Zäune.
So ist nach anfänglichem Spaß, nachdem das Regime und seine Gefolgsmänner so richtig durch den Kakao gezogen worden ist, auch die Spannung Trumpf. Mit einem alten Lkw geht es tags wie nachts durch eine absolut lebensfeindliche Umgebung, während sich die Verfolger bereits an ihre Fersen geheftet haben. Das wird zeitweilig durch Humor aufgelockert, wie es einer Fantomas-Verfilmung zueigen ist. Bereits nach der Lektüre dieses Abenteuers lässt es sich nicht leugnen, dass eine kindliche Leserschaft ihren Spaß an Jeff Jordan haben kann. Tillieux erzählt und zeichnet zeitlos, vor allem zeitlos gut.
Wo es einerseits sehr französisch zugeht, dürfen Verbeugungen vor anderen Klassikern des Detektiv-Genres nicht fehlen. Der Titel Die Nacht des schwarzen Hundes deutet es fast schon zur Genüge an. Wenn ein Hausherr dann noch Barney Basker heißt, ihm ein Hund nach dem Leben trachten soll, werden Erinnerungen an den Hund von Baskerville wach. Zwar spricht Teddy hier auch Edgar Wallace an, nach dessen Motiven auch ein Hund von Blackwood Castle ins Rennen geschickt wurde, aber andere Indizien lassen eher auf eine Verbeugung vor Arthur Conan Doyle schließen. Wie in Die Liga der Rothaarigen dient eine einfallsreiche Mär nur als Ablenkungsmanöver.
Die nächste Verbeugung lässt nicht lange auf sich warten. Der rote Mönch ist fast mehr als nur eine Verbeugung vor dem Schwarzen Abt oder dem Unheimlichen Mönch eines Edgar Wallace. In anderer Hinsicht ist es aber auch ein charmanter Knicks vor dem Landleben und liebevollen Komödien, die sich mit dem doch sehr eigenen Charakter mancher Landbevölkerung beschäftigen. Mit einem feinen Blick zeigt Tillieux, was sich einer einfallen lassen kann, wenn es um die Ankurbelung des Tourismus und die Erschließung neuer Einnahmequellen geht.
Grafisch geht Maurice Tillieux etwas routinierter und kräftiger, vielleicht sogar sicherer zu Werke. Jeff Jordan ist der erzählerische und optische Leitwolf der Reihe, aber Teddy Bär hat sich zu einem heimlichen Star entwickelt. Die Figur des stets zu Späßen aufgelegten Assistenten, der am meisten über seine eigenen Scherze lachen kann, ist einfach und doch schlicht großartig. Zuerst kann man als Leser nur über diesen Charakter schmunzeln. Bis es einen packt. In stilsicheren Strichen gestaltet Tillieux seine Figuren, treffsicher und sauber wird die Realität abgebildet, eine perfekte Kulisse für die Komödie, die Tillieux hier aus Versatzstücken wie auch eigenen Ideen schafft.
Schlicht gesagt: Bestens. So machten es die Funnys einstmals vor und so funktioniert es immer noch. Humor und Spannung kennen eben kein Alter. Wer auf feinem Niveau lachen und spannend unterhalten sein will, liegt mit dem Jungspund Jeff Jordan genau richtig. 🙂
Jeff Jordan Gesamtausgabe 2: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 31. Dezember 2009
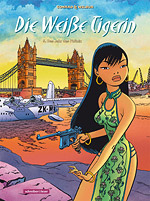 Die weißen Tigerinnen haben ein Geheimnis. Es gibt einen ungewöhnlichen Weg, die Geheimagentinnen zu identifizieren. Es ist ein Erkennungszeichen, das nur Eingeweihte kennen dürfen. Leider, wie so oft in der Geheimdienstbranche, gerät das Geheimnis in die falschen Hände. Für Alix Yin Fu ist dies der Auftakt zu einem neuen Abenteuer, das sie diesmal in weite Ferne führt, ins Herz des europäischen Kolonialismus: Nach London. Ein Glück für sie ist, dass sie diese Reise nicht alleine bestreiten muss. Zwischen all jenen, deren Befehle sie bislang befolgte, gibt es nämlich einen, dem sie uneingeschränkt vertrauen kann: Maurice Rousseau, den alle nur den Dreifarbigen Drachen nennen.
Die weißen Tigerinnen haben ein Geheimnis. Es gibt einen ungewöhnlichen Weg, die Geheimagentinnen zu identifizieren. Es ist ein Erkennungszeichen, das nur Eingeweihte kennen dürfen. Leider, wie so oft in der Geheimdienstbranche, gerät das Geheimnis in die falschen Hände. Für Alix Yin Fu ist dies der Auftakt zu einem neuen Abenteuer, das sie diesmal in weite Ferne führt, ins Herz des europäischen Kolonialismus: Nach London. Ein Glück für sie ist, dass sie diese Reise nicht alleine bestreiten muss. Zwischen all jenen, deren Befehle sie bislang befolgte, gibt es nämlich einen, dem sie uneingeschränkt vertrauen kann: Maurice Rousseau, den alle nur den Dreifarbigen Drachen nennen.
Die weißen Tigerinnen müssen fliehen. Nach allem, was die Agentinnen durchgestanden haben, nach all der Treue, mit der sie ihren Dienst versehen, ist Flucht das einzige, das noch geblieben ist, um ihre Organisation zu retten. Alix Yin Fu, eine ansonsten schon sehr zurückhaltende junge Frau, hat infolge der Ereignisse noch weniger Grund zum Lächeln als gewöhnlich. Hinzu kommt, dass es eine der gefährlichsten Missionen ihres Lebens ist.
Wilbur (Autor) und Conrad (Zeichner) haben eine spannende Geschichte ausgeheckt, die ein Agentenszenario vom Feinsten ist. Im Mutterland des MI6 darf ein entsprechender Geheimagent natürlich nicht fehlen. Nach mit dem Dreifarbigen Drachen bereits in Schauspieler karikiert wurde (Jean Reno), darf sich ein Mann, dessen schmalen Augen, kantiges Kinn und leicht abstehenden Ohren dem bekanntesten Geheimagenten der Leinwandgeschichte ein neues Gesicht gegeben haben, nun auf seinen Gastauftritt freuen (Daniel Craig). Einzig mit der Haarfarbe (rot) haben sich die Macher eine deutliche Abweichung erlaubt.
Komödiantisch, aber alles andere als zum Lachen. Die vorliegende Episode einer Reihe, die bisher Humor, Action und Spannung gut in Einklang bringen konnte, setzt hier fast vollständig auf die ernsten Seiten des Geheimdienstgeschäfts. Der Auftakt zeigt sofort die Grundrichtung der Handlung auf. Diese Richtung wird nicht nur beibehalten, sondern geht steil bergauf. Mit der Flucht aus China müssen zugunsten ihrer Herrin eine Menge Tigerinnen ihr Leben lassen. An dieser wie auch vielen anderen Stellen ist keine Gelegenheit für Spaß. Ähnlich wie Daniel Craig einen Bond auf den Kopf stellte, sorgt Wilbur, der Ersatz für seinen Vorgänger Yann, für ungewohnten Wind. Im 4. Teil der Reihe war diese Wende zu mehr Realismus nicht so stark spürbar.
Grafisch bleibt Didier Conrad der bisherigen Linie treu. Wo der Humor im Szenario fehlt, kann Conrad immer noch mit seinen Bildern punkten. Es mag für einen Leser ungewohnt sein, einen wirklich handfesten Thriller in dieser Form zu lesen, aber die Härte wird auf diese Art etwas unterdrückt. In einer realistischen Darstellung könnte die vorliegende Geschichte auf Augenhöhe mit Reihen wie Largo Winch mitspielen.
Wir schreiben das Jahr 1947. Gut für Didier Conrad, denn so kann er wunderbar mit Ausstattungen der damaligen Zeit jonglieren. Die Landung eines großen Wasserflugzeugs auf der Themse (heute kaum mehr vorstellbar), alte bullige Automobile (heute sind es Autos, früher waren es Automobile, selbst das kleinste von ihnen), die sich Verfolgungsjagden liefern. Schöne Dialogszenen wechseln sich mit Aktionsansichten ab, die auch der Fantasie eines Alistair MacLean entsprungen sein könnten.
Tolle Spionagethrillerunterhaltung! Conrad und Wilbur schlagen eine noch härtere Gangart ein. Die Schule scheint für Alix Yin Fu endgültig vorüber zu sein. Wer ernsthafte Spannungsunterhaltung im Cartoon-Gewand mag, dem sei der 5. Teil der Reihe um die weiße Tigerin wärmstens ans Herz gelegt.
Die weiße Tigerin 5, Das Jahr des Phönix: Bei Amazon bestellen
Oder bei Schreiber und Leser.
Donnerstag, 10. Dezember 2009
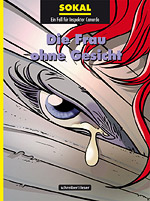 Canardo lässt es sich gut ergehen. Leben und leben lassen, so könnte sein Motto lauten. Deshalb kann er auch nicht nein sagen, als Galinka, eine Vertreterin des horizontalen Gewerbes ihn bittet, sie nach Hause zu fahren. Natürlich versucht sie beiläufig Canardo herumzubekommen, doch der Detektiv kann sich einen derart teuren Abendabschluss nicht leisten. Die Fahrt geht heimwärts in Canardos altem Cadillac Eldorado Biarritz. Leider wissen nicht alle Verkehrsteilnehmer Canardos klassisches Automobil zu würdigen. Ein brutaler Zusammenstoß bringt den amerikanischen Straßenkreuzer samt Insassen von der Straße ab, geradewegs hinein ins Hafenbecken.
Canardo lässt es sich gut ergehen. Leben und leben lassen, so könnte sein Motto lauten. Deshalb kann er auch nicht nein sagen, als Galinka, eine Vertreterin des horizontalen Gewerbes ihn bittet, sie nach Hause zu fahren. Natürlich versucht sie beiläufig Canardo herumzubekommen, doch der Detektiv kann sich einen derart teuren Abendabschluss nicht leisten. Die Fahrt geht heimwärts in Canardos altem Cadillac Eldorado Biarritz. Leider wissen nicht alle Verkehrsteilnehmer Canardos klassisches Automobil zu würdigen. Ein brutaler Zusammenstoß bringt den amerikanischen Straßenkreuzer samt Insassen von der Straße ab, geradewegs hinein ins Hafenbecken.
Der Verkehrsrowdy, der sie mit seinem Porsche regelrecht von der Straße geschossen hat, besitzt immerhin ein schlechtes Gewissen. Ein Trost ist das nicht. Nicht für Canardo, dessen Fuß eine längere Genesungsphase benötigt. Nicht für Galinka, die nun eine Frau ohne Gesicht ist und eine noch viel längere Behandlung über sich ergehen lassen muss. Gott sei Dank sind die Möglichkeiten der Gesichtschirurgie weit gediehen. Fragt sich nur, wie hat Galinka vor dem Unfall eigentlich ausgesehen? Aber dafür gibt es schließlich Fotos …
Inspektor Canardo, der Mann, dem keine Gefühlsregung zu schwer ist, der sich aber nicht besonders bemüht, diese darzustellen, gerät nach diversen Ausflügen in das bürgerliche Leben, nach Auseinandersetzungen mit Terroristen und Geiselnehmern, sogar nach Zeitreisen nun in Adelskreise. Gleichwohl gehen ihm auch diese Kreise mit seiner gewohnt schnoddrigen Art an seinen Hinterbacken vorbei. Die Herzogin des Kleinherzogtums Belgamburg sieht die Angelegenheit weitaus weniger lässig. Sokal beschreibt eine Adelssippe mit einem Problem. Dieses Problem heißt: Nachwuchs.
Den gibt es zwar, doch der ist alles andere als für diesen Posten geboren, ein Problem, das Sokal nicht aus der Luft gegriffen hat, wenn man den einschlägigen Klatschmeldungen glauben darf. Allerdings geht Sokal im Stile einer Kriminalgeschichte noch einen Schritt weiter. Frau Herzogin hat nur das Ansehen des Herzogtums im Blick. Die Eskapaden ihres Sohnes Nono jedoch sind ein beständiges Ärgernis. Wenn eine Mutter den Wunsch äußert, ihrem Sohn den Testikel zu entfernen (höflich ausgedrückt), dann ist etwas faul im Kleinherzogtum Belgamburg.
Sokal entwirft ein kleines, aber feines Ränkespiel wie auch Verwirrspiel um die Vorlieben des Thronfolgers von Belgamburg. Mit einer gewissen Süffisanz, den Canardo mit seinem Spötteln transportiert, schildert Autor und Zeichner Sokal das ziemlich unspektakuläre Leben bei Hofe, zeigt dem Leser ein Paar (wirklich nur zwei) auf der Lauer liegende Paparazzi und die Gespräche hinter den verschlossenen der (sehr kleinen) Macht. Sokal zeigt jedoch auch, dass auch eine kleine Macht eine Macht ist, die mit ihren Werkzeugen zu hantieren weiß. Ganz nebenbei bringt er den altbekannten (und einigermaßen unverständlichen) Streit der belgischen Ureinwohner zur Sprache, indem er die Wallonen einen sehr großen Traum eines noch größeren wallonischen unabhängigen Staates träumen lässt.
Die Frau ohne Gesicht wird zum Bindeglied der einzelnen Bestandteile der Handlung. Keine Brücke, eher eine Kette, an der unterschiedliche Fraktionen aus unterschiedlichen Gründen zerren. Eine der besten Szenen findet sich in einer Begegnung zwischen der Herzogin und Galinkas ehemaligem Zuhälter. Der Mann vom Kiez wundert sich sehr, dass eine Herzogin in Sachen Unterweltsprache ebenso viel zu bieten hat wie er. Überhaupt hat Sokal mit der Herzogin einen Drachen erschaffen, der irgendwie an die eiserne Lady erinnert. In einer Verfilmung hätte man hier eine Anwärterin auf den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle.
Durchgehend im bekannten Sokal-Stil gezeichnet, entführt die Frau ohne Gesicht den Leser in die Abgründe der Adelskreise und der niederen Politik. Gewohnt bissig, mit pechschwarzem Humor ausgestattet, bietet auch die 18. Folge von Inspektor Canardo beste Krimiunterhaltung. 🙂
Ein Fall für Inspektor Canardo 18, Die Frau ohne Gesicht: Bei Amazon bestellen
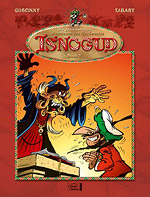 Ein kleines Männlein kommt aus der Hölle (nein, nicht Isnogud) und muss voller Verwunderung feststellen, dass der Großwesir immer noch Unterwürfigkeit heuchelt. Zwar strengt sich Isnogud immer noch hartnäckig an, sein Ziel zu erreichen (Kalif werden anstelle des Kalifen), aber irgendwie mangelt es an der dazu nötigen Portion Glück. Glück sollte der Großwesir denn auch wenigstens an seinem Geburtstag haben: Aber auch hier Fehlanzeige. Er stürmt wieder munter voran, lässt seinem Ungestüm freien Lauf, seinem Jähzorn sowieso und so kommt es, dass die wirklich perfekte Gelegenheit wieder an ihm vorbeizieht.
Ein kleines Männlein kommt aus der Hölle (nein, nicht Isnogud) und muss voller Verwunderung feststellen, dass der Großwesir immer noch Unterwürfigkeit heuchelt. Zwar strengt sich Isnogud immer noch hartnäckig an, sein Ziel zu erreichen (Kalif werden anstelle des Kalifen), aber irgendwie mangelt es an der dazu nötigen Portion Glück. Glück sollte der Großwesir denn auch wenigstens an seinem Geburtstag haben: Aber auch hier Fehlanzeige. Er stürmt wieder munter voran, lässt seinem Ungestüm freien Lauf, seinem Jähzorn sowieso und so kommt es, dass die wirklich perfekte Gelegenheit wieder an ihm vorbeizieht.