Freitag, 13. Februar 2009
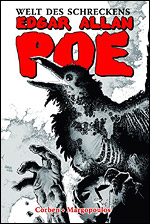 Der Priester hat seine Arbeit vollbracht. Die Schläferin, die Vampirin, die nächtens die Lebenden terrorisierte, ist nun endgültig tot. Ihr Kopf wurde vom Rumpf getrennt, wie es für die Vernichtung eines Vampirs vorgeschrieben ist. Aber der Priester hat ihren Meister vergessen, den, der die Schläferin erschaffen hat. Kurz darauf schlagen sich messerscharfe Zähne in den Hals des Priesters, der panisch reagiert und mit seinem Kreuz zusticht. In dieser Welt des Schreckens sind Vampire allerdings noch das kleinste Übel. Viel schlimmer ist der Mensch, der mordet und meuchelt und der dennoch immer wieder auf das Fürchterlichste lächelt.
Der Priester hat seine Arbeit vollbracht. Die Schläferin, die Vampirin, die nächtens die Lebenden terrorisierte, ist nun endgültig tot. Ihr Kopf wurde vom Rumpf getrennt, wie es für die Vernichtung eines Vampirs vorgeschrieben ist. Aber der Priester hat ihren Meister vergessen, den, der die Schläferin erschaffen hat. Kurz darauf schlagen sich messerscharfe Zähne in den Hals des Priesters, der panisch reagiert und mit seinem Kreuz zusticht. In dieser Welt des Schreckens sind Vampire allerdings noch das kleinste Übel. Viel schlimmer ist der Mensch, der mordet und meuchelt und der dennoch immer wieder auf das Fürchterlichste lächelt.
Obwohl er nur 40 Jahre alt wurde, hat Edgar Allan Poe mit seinen Geschichten Vorreiter für unheimliche und hintergründige Handlungen gespielt. Der von 1809 bis 1849 lebende Autor schrieb Geschichten wie Der Goldkäfer oder Der Doppelmord in der Rue Morgue. Filme nach seinen Themen katapultierten den Filmschauspieler Vincent Price in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. So erfreuten sich plötzlich Das Pendel des Todes, Der Untergang des Hauses Usher, Die Maske des Roten Todes oder auch Der Rabe wieder einer größeren Beliebtheit. Dieses Gedicht von Poe diente als Vorlage zur Verfilmung unter dem Titel Der Rabe – Duell der Zauberer. Der Film mit Vincent Price, Peter Lorre und Boris Karloff war eine grandiose Komödie.
Im vorliegenden Band interpretiert Autor Rich Margopoulos die Textvorlagen von Edgar Allan Poe weniger humorvoll. Der Rabe weist in der Interpretation den Weg zu einer alten Schuld. Ist das Gedicht in seiner Urform bereits düster, schwarz umwölkt, erdrückt der Verlust den Erzähler, kann Margopoulos dies in seiner Umsetzung noch eindeutiger festlegen. Der Rabe wird zum Todesboten – ein Motiv, das James O’Barr mit seiner Geschichte The Crow wieder aufgriff.
Die Interpretationen stehen Seite an Seite mit den alten Texten und entlocken ihnen neue Bedeutungen oder transportieren sie in die Neuzeit. Der Sieger Wurm, thematisch auch von Mike Mignola mit seinem Hellboy aufgegriffen worde, wird hier zu apokalyptischen Grauen in der Zukunft, fast einer Art neuen Form des Soylent Green. Die Würmer haben den Sieg davongetragen. Am Ende sind sie es, die mit Menschen gefüttert werden, damit eine bestimmte Kolonie von Menschen überleben kann. Der Mensch frisst sich über einen Umweg selbst.
Damit dieser Horrorverbund gelingen kann, wurde ein Künstler verpflichtet, der seit langem ein Garant für den gepflegten Grusel, aber auch für den knallharten Horror ist: Richard Corben. 1940 geboren, aber noch lange nicht zum alten Eisen gehörend, greift mit Freude die Vorlagen von Margopoulos auf und verknüpft die alten Texte mit Gewalt, aber auch Gesellschaftskritik oder gesellschaftlichen Einsichten. Mit zweierlei Techniken geht Corben ans Werk. Auf Farbe, wie bei seinem Cover zu Bat out of hell von Meat Loaf, mit dem er ein noch größeres Publikum erreichte, verzichtet er vollkommen. Er setzt auf Licht und Schatten. In manchen Geschichten verwendet er ein plakatives Helldunkel, gestützt von einigen bewusst gesetzten Grautönen. Andere Geschichten, die optisch so auch viel atmosphärischer werden, arbeitet er feinsäuberlich in Graustufen aus und gibt ihnen einen metallischen Glanz, aber auch eine höhere Räumlichkeit.
Corbens Figuren haben zuweilen die Eigenschaft, ins Lächerliche abzudriften. Sie karikieren, wenn die Köpfe viel zu groß geraten und der gesamte Körperbau mehr der von Marionetten ist. Eigentlich sollte derlei Gestaltung einer Geschichte die Schärfe nehmen, da sie dadurch der Realität noch mehr entrückt wird. Das ist bei Corben aber nicht der Fall. Corben lässt einen Rausch entstehen. Seine Bilder entführen den Leser so, als habe eine Reizüberflutung stattgefunden oder das Gehirn könne die Informationen nicht mehr zur Gänze sinnvoll verarbeiten. Man muss sich darauf einlassen können oder es optisch mögen, allenfalls werden die Bilder ihre Kraft nicht entfalten können.
Eine Fahrt mit der guten alten Geisterbahn nach einem Schlag auf den Kopf: Rich Margopoulos und Richard Corben nehmen den Leser mit ihren Interpretationen von Edgar Allan Poe Themen auf einen Horrortaumel mit. Das Ziel der Reise ist der menschliche Abgrund und der ist, will man diesem Trio glauben, verdammt tief. 🙂
Welt des Schreckens – Edgar Allan Poe: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 12. Februar 2009
 Der Planet Kiros wollte den Krieg nicht. Er bekam ihn trotzdem. Kiurz nachdem der örtliche Gouverneur mit Yoda über die Hilflosigkeit seines Volkes in diesem Konflikt gesprochen hat, landet Count Dooku mit seinen Droideneinheiten. Unter der Vorspiegelung einer friedlichen Besetzung Kiros’ will er ein Bollwerk gegen die vorrückenden republikanischen Einheiten schaffen. 19 Umkreisungen später ist der Krieg auch auf Kiros in vollem Gange. Der Versuch, eine Neutralität zu wahren, hat nichts genützt. Geradezu spielerisch gehen die Klontruppen gegen die Droiden vor. Sie vergeben sich gegenseitig Punkte für Abschüsse. Wie ernst die Lage wirklich ist, erfahren sie durch den Erhalt einer Bombendrohung.
Der Planet Kiros wollte den Krieg nicht. Er bekam ihn trotzdem. Kiurz nachdem der örtliche Gouverneur mit Yoda über die Hilflosigkeit seines Volkes in diesem Konflikt gesprochen hat, landet Count Dooku mit seinen Droideneinheiten. Unter der Vorspiegelung einer friedlichen Besetzung Kiros’ will er ein Bollwerk gegen die vorrückenden republikanischen Einheiten schaffen. 19 Umkreisungen später ist der Krieg auch auf Kiros in vollem Gange. Der Versuch, eine Neutralität zu wahren, hat nichts genützt. Geradezu spielerisch gehen die Klontruppen gegen die Droiden vor. Sie vergeben sich gegenseitig Punkte für Abschüsse. Wie ernst die Lage wirklich ist, erfahren sie durch den Erhalt einer Bombendrohung.
General Kenobi hat einen Punkt erreicht, ab dem er mit Bedacht vorgehen muss. Die Togruta, die Bewohner von Kiros, sind verschwunden. Die Drohung nicht ernst zu nehmen, hieße, ein allzu großes Risiko für Leib und Leben der Togruta einzugehen. Während Kenobi Zeit herausschindet, suchen Anakin, die Padawan Ahsoka und R2-D2 nach den versteckten Bomben.
Mit diesem Handlungsauftakt folgt Henry Gilroy der Zeichentrick- und Animationsfortführung des Star Wars Themas. Vor geraumer Zeit sorgte die kleine Zeichentrickserie zu den Clone Wars für Aufregung. Endlich gab es neues Handlungsfutter. Aus der Zeichentrickserie wurde ein Animationskinofilm und eine –serie. Die optische Grundkonzeption wurde beibehalten, lediglich setzte man bei der Umsetzung verstärkt auf einen CGI-Ausdruck. Durch die verschiedenen Serienbestandteile ist zwischen den Ereignissen von Episode II und Episode III bald sehr viel mehr los, als es zwischen der Rache der Sith und einer neuen Hoffnung ist.
Die 72. Ausgabe der Star Wars Comic-Reihe greift die Clone Wars auf und erzählt von den Auseinandersetzungen im Kiros System und dem Schicksal der dortigen Togruta Kolonie. Henry Gilroy schrieb das Skript zum Comic. Es fasst die ersten beiden Ausgaben der US-amerikanischen Clone Wars Reihe zusammen. Gilroy ist versiert in der Zeichentrickunterhaltung wie auch in der Unterhaltung von Kindern. Er arbeitete u.a. mit an den Serien Jackie Chan Adventures, Batman, Bionicle, Transformers Animated und natürlich auch am Clone Wars Kinofilm. Gilroy kennt die Regeln der Erzählung. So sät er zunächst Hoffnung, um sie sogleich wieder zu nehmen.
Dem Gespräch mit Yoda folgt die Landung von Count Dooku und seinen Truppen auf dem Fuße. Die Kämpfe, die kurz darauf zu sehen sind, hat der Fan so ähnlich schon in der originalen Zeichentrickserie bestaunen können. Das spannungsverschärfende Stichwort in dieser Geschichte lautet: Bomben. Gilroy setzt die Handlung unter Zeitdruck. Außerdem stimmt Obi-Wan Kenobi einem Zweikampf zu, bei dem er auf seine Jedi-Fähigkeiten verzichten will.
Die Bilder sind grafisch an die Optik der Clone Wars Reihe angelehnt, entsprechen aber eher der ursprünglichen Zeichentrickserie. Scott Hepburn orientiert sich nicht so stark an dieser Optik wie sein Nachfolger Ramon K. Perez in der zweiten Episode. Wegen ihres größeren Realismus wirken Hepburns Bilder besser. Dan Parsons tuscht die erste Episode auch deutlich kräftiger als die zweite. Insgesamt ist die Umsetzung der Zeichentrickvorlage für beide Zeichner aber offensichtlich schwierig. Die kantigen Formen lassen es nicht zu, dass alle möglichen Perspektiven genutzt werden können, denn es würde einfach nicht wirken. In einem Film kann eine Bewegung über eine seltsame Optik hinwegtäuschen, hier ist das nicht möglich.
Nichtsdestotrotz hat der vorliegende Band einiges zu bieten, besonders als sich die Handlung in den Weltraum verlegt. Für den kleinen Star Wars Hunger zwischendurch, leicht verdaulich und lecker. 🙂
Dienstag, 10. Februar 2009
 Die Planetenoberfläche ist zerfurcht, voller Matsch. Es regnet unaufhörlich. Dennoch setzen die Klontruppen unter dem Befehl von General Kenobi ihren Vormarsch fort. Aber Alto Stratus, der Oberbefehlshaber der Separatistentruppen von Jabiim, macht es den Klontruppen nicht leicht. Zu tiefe Wunden haben die Versäumnisse der Republik bei den Bewohnern von Jabiim hinterlassen, um noch auf Hilfe zu hoffen. Lieber streben sie die Unabhängigkeit an. Die Angriffe der Aufständischen haben die Reihen der Klontruppen weit auseinander gezogen und geschwächt. Entgegen des Rats seiner Soldaten hat sich Kenobi in die Falle locken lassen. Plötzlich kommt ein Funkspruch Anakins. Der Feind greift das Hauptlager an!
Die Planetenoberfläche ist zerfurcht, voller Matsch. Es regnet unaufhörlich. Dennoch setzen die Klontruppen unter dem Befehl von General Kenobi ihren Vormarsch fort. Aber Alto Stratus, der Oberbefehlshaber der Separatistentruppen von Jabiim, macht es den Klontruppen nicht leicht. Zu tiefe Wunden haben die Versäumnisse der Republik bei den Bewohnern von Jabiim hinterlassen, um noch auf Hilfe zu hoffen. Lieber streben sie die Unabhängigkeit an. Die Angriffe der Aufständischen haben die Reihen der Klontruppen weit auseinander gezogen und geschwächt. Entgegen des Rats seiner Soldaten hat sich Kenobi in die Falle locken lassen. Plötzlich kommt ein Funkspruch Anakins. Der Feind greift das Hauptlager an!
Die Verluste werden immer höher. Beide Feindparteien werden sich auf dem Schlachtfeld immer ähnlicher. Die Lage wird für beide Seiten immer verzweifelter. Die Jedi, besonders die Padawane werden in eine Situation getrieben, die sie an den Grundsätzen des Ordens zweifeln lässt. Bald schon sind sie bereit aufzugeben – alles, nicht nur den Kampf, sondern auch ihr Leben. Zu allem Überfluss ruft der Oberste Kanzler die verbliebenen Truppen zur Evakuierung auf.
Tag auf Tag lässt Autor Haden Blackman auf die Jedi und ihre Soldaten wie Hammerschläge niedergehen. Der nächste Tag ist schlimmer als der vorherige. Es werden keine Siege errungen, dafür sind sie zu teuer erkauft. Die einstige Euphorie, das Wissen um die Richtigkeit des eigenen Tuns ist einem bloßen Kämpfen um Leid und Leben gewichen. Selten war im Action-geladenen Clone Wars-Umfeld die Stimmung derart trostlos.
Diese Stimmung gipfelt im Tod dreier junger Jedis. Zwei von ihnen sterben mehr oder minder freiwillig unter dem Einschlag einer Raketensalve. Er ist zu kraftlos, um die Salve abzuwehren, sie will ihn nicht alleine sterben lassen, obwohl er ihr die Möglichkeit zur Flucht verschafft hätte. Eine dritte Jedi stirbt, als sie Rache nehmen will für all das Leid und Grauen, dass sie während der Kämpfe miterleben musste. Wie in einem Szenario von Hermann Melville reißt auch hier der Feind seinen Widersacher mit in den Tod.
Als Zeichner für dieses Kriegsdrama inmitten sonst eher oberflächlichen Gesamtszenarios zwischen Episode III und Episode IV konnte Brian Ching gewonnen werden. Ching wurde mit seinen Arbeiten an Tomb Raider, Witchblade oder auch der Magdalena bekannt. Auch im Star Wars-Universum hat er bisher einige bemerkenswerte Arbeiten abgeliefert.
Brian Ching gehört zu der Sorte Zeichner, die sich dem Realismus verschrieben haben. Seine Menschen sind zwar ein wenig überirdisch, aber damit reiht er sich hinter Größen wie Dan Jurgens, Jim Lee, Terry Dodson oder Michael Turner ein. Ching hat immer ein wenig Grundähnlichkeit in seinen Figuren, eine Schwäche, die vielen guten Zeichnern zueigen zu sein scheint. Dies lässt aber vielleicht auch mit dem zeichnerischen Alltag erklären. Im Tagesgeschäft verhelfen Grundformen und –stile zu einer schnelleren Umsetzung. Und wenn diese so toll und exakt ausfallen wie bei Ching, mag man als Leser eine solch kleine Schwäche gerne verzeihen.
An der Art und Weise und der daraus resultierenden Wirkung, wie Ching diesen Kriegsschauplatz optisch aufbereitet, erkennt man als Leser schnell den Unterschied zu bisherigen Star Wars Veröffentlichungen. Diese waren nicht gewaltfrei – schon gar nicht jene Geschichten zum Thema Clone Wars – doch hier wirkt die Gewalt echter, soweit sich das von einem Space Opera Szenario sagen lässt. Der Fan mag sich ein wenig aufgrund der Härte an den Roman Mace Windu und die Armee der Klone erinnert fühlen.
Optisch nicht weniger gelungen die von Jan Duursema gezeichnete Abschlussepisode, die allerdings mit dem Letzten Gefecht um Jabiim nichts mehr zu tun hat. John Ostrander schickt seinen Helden Anakin Skywalker auf den Planeten Aargonar. In der Episode Der Sturm vor dem Sturm steht ihm ausgerechnet ein Jedi-Meister aus dem Volk der Tusken zur Seite. Anakin, der diesem Volk immer noch den Tod seiner Mutter anlastet, macht es sich nicht leicht an der Seite von A’Sharad Hett.
Duursema zeichnet diese kleine Geschichte mit der von ihm gewohnten Akribie. Er legt wie Ching einen hohen Wert auf den Realismus seiner Zeichnungen. Auf seine besitzen eine große Sogkraft, stets sind die Seiten optisch sehr ausgewogen und zeugen von einer tollen Sichtführung des Lesers.
Das letzte Gefecht um Jabiim bringt einen sehr düsteren Realismus in die Space Opera zurück. Wer ein hartes Science Fiction Abenteuer bevorzugt oder sehen will, wozu Star Wars erzählerisch auch fähig ist, sollte einen Blick riskieren. 🙂
Star Wars – Clone Wars 3 – Das letzte Gefecht um Jabiim: Bei Amazon bestellen
Sonntag, 08. Februar 2009
 Spider-Man ist der Star im Ring. Keiner der anderen Wrestler kann ihm das Wasser reichen. Der junge Peter Parker glaubt nicht, dass es noch besser werden kann. Er hat Geld und Anerkennung. Das Publikum liebt ihn. – Aber das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war Peter Parker, der Junge hinter der roten Maske mit der dunklen Augenumrandung einer der größten Verlierer seiner Schule. Immer musste er als Prügelknabe herhalten. Besonders Flash Thompson machte ihm das Leben schwer. Bis die Spinne kam. Dann änderte sich alles. Beinahe jedenfalls.
Spider-Man ist der Star im Ring. Keiner der anderen Wrestler kann ihm das Wasser reichen. Der junge Peter Parker glaubt nicht, dass es noch besser werden kann. Er hat Geld und Anerkennung. Das Publikum liebt ihn. – Aber das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war Peter Parker, der Junge hinter der roten Maske mit der dunklen Augenumrandung einer der größten Verlierer seiner Schule. Immer musste er als Prügelknabe herhalten. Besonders Flash Thompson machte ihm das Leben schwer. Bis die Spinne kam. Dann änderte sich alles. Beinahe jedenfalls.
Peter Parker genoss seine neuen Fähigkeiten, aber er hängte sie nicht an die große Glocke. Es genügte zuerst, Flash aus dem Weg gehen zu können. Doch dann wollte Peter mehr. Er wollte das, was alle Jungs seines Alters wollen. Ein vorzeigbares Auto, um Mädchen zu beeindrucken. Und natürlich, um sie abzuschleppen. Ein Kampf mit einem Wrestler versprach ein Preisgeld, das die Lösung seiner Probleme sein konnte. So rutschte Peter in ein Milieu hinein, von dem er vorher nicht einmal geträumt hatte. Schlimmer noch, plötzlich hatte er auf eine gewisse Art mit dem organisierten Verbrechen zu tun.
David Lapham unternimmt den Versuch einer Neuerzählung. Was wäre wenn ist seit längerem ein beliebtes Mittel, um bestehenden Szenarien oder Figuren einen neuen ungewohnten Anstrich zu verpassen. Superman – Birthright war ein derartiger Versuch, das Ultimative Universum ist ein weiterer, noch umfangreicherer Schritt in diese Richtung. Diese Spider-Man-Variante löst sich von allen Richtungen, in die inzwischen erzählt wird – und die aus Lesersicht mittlerweile sehr unübersichtlich geworden sind – und beginnt ganz einfach von vorne. David Lapham verfolgt eine ganz einfache Frage: Hätte Peter Parker Geschmack am Wrestling gefunden, was hätte aus ihm werden können?
Wirft man einen Blick auf den Auftakt der Geschichte, ist die Antwort einfach: Ein ziemlich arroganter, eingebildeter junger Schnösel, der sich von einer ältlichen Frau bequatschen lässt, weil er mehr Augen für ihr Décolleté hat, als Ohren für ihre Worte.
Das Leben ist nicht toll. Nein, kein Zuckerschlecken. Aber es wird besser. Es wird immer besser.
Die Erfolge, die Lapham seinem jungen Helden angedeihen lässt, sind ihm aus den Rückblenden her zu gönnen. Sehr schnell ist man als Leser allerdings hin und her gerissen, denn die berühmten Worte von Onkel Ben (Aus großer Kraft …) führen bei Peter zu keiner großen Verantwortung. Dennoch – oder vielleicht genau deswegen – schießt sich der Daily Bugle auf Spider-Man ein. Ein Mensch mit derartigen Fähigkeiten kann nicht einfach nur ein Wrestler sein. Die Wende kommt durch ein einschneidendes Erlebnis mit den Fantastischen Vier, genauer dem Ding alias Ben Grimm. Erst dann beginnt sehr langsam aus Peter das zu werden, was der Leser auch aus anderen Universen her kennt. Aber leicht macht es Lapham seinem deshalb noch lange nicht.
Tony Harris, den Zeichner, kennen eingefleischte Comic-Fans vielleicht von seinen Arbeiten aus der Serie Ex Machina. Dort hat er durch seinen sehr realistischen und gleichzeitig verspielten Zeichenstil beeindruckt. Zu Beginn muss Harris seinen Schützling durch zwei Welten, durch ein Doppelleben führen. An der Schule ist er der schmale Junge. Wer sich die Optik betrachtet und Film-Fan ist, wird vielleicht eine gewisse Parallele zu George McFly und Biff Tannen festellen. Peter Parker und Flash Thompson geben hier ein ähnliches Bild ab. Der Vergleich mit den 50er Jahren wird umso deutlicher, wenn eine ganz bestimmte Szene herangezogen wird. Peter und Flash liefern sich ein Straßenrennen, bei dem Peter seinen Spinnensinn als Joker benutzt.
Neben packenden Sequenzen im Ring und mit den Fantastischen Vier als Nebendarstellern darf sich Harris auch mit der Maskerade von Peter befassen. Die Verkleidung entsteht nicht durch einen Geistesblitz, sondern folgt verschiedenen Stadien (sogar mit einer merkwürdigen Augenumrandung), bis das bekannte Erscheinungsbild erreicht ist. Insgesamt ist es Harris zu verdanken, dass dieses Spiel mit einer Alternativwelt so gut gelingt. Sein Peter Parker, auch sein Spider-Man ist mit einer so schönen Anteilnahme an der Figur und einer hohen Präzision zu Papier gebracht, dass auch diese Version schlichtweg funktioniert. (Auch weil der Leser viel länger etwas von Onkel Ben hat.)
Farblich ist Schwarz nur als dunkelste Druckfarbe zu finden, wenn es auch Sinn macht. Kolorist J.D. Mettler scheut sich nicht, die getuschten Flächen und Linien seines Kollegen Jim Clark anders einzufärben, so dass eine bessere optische Anpassung an Schattierungen entsteht. Eine deutlich höhere Räumlichkeit ist das Ergebnis. Die Kolorierung allgemein schlicht zu nennen, wäre falsch. Tatsache ist aber, dass die exakte Zeichenweise von Harris mit viel weniger Schattierungsstufen auskommt. Wo es wirklich rundgeht – wie das Ding immer sagt – ist während des Auftritts Ben Grimms zu sehen. Zeichnung und Farbe lassen die Figur viel klobiger aussehen als gewöhnlich, obwohl sie tatsächlich schlanker ist als so manche andere Darstellung dieses Charakters.
Eine gelungene und sehr schön anzuschauende alternative Welt von Spider-Man. David Lapham stellt Peter Parker vor neue Herausforderungen, indem er ihm altbekannte Wendungen vorenthält. Top gezeichnet von Tony Harris. 🙂
Mittwoch, 04. Februar 2009
 Die Zeiten haben sich geändert und es besteht für die Menschen keinerlei Veranlassung mehr mit Hochmut ihren Weg zu beschreiten. Nach ihrer verhängnisvollen Niederlage gegen die Drekkars und die Drachen blieb es lange Zeit still. Einzig der Zwist untereinander zerriss den Frieden. Doch nun naht eine neuerliche Zeitenwende, die niemand vorhergesehen hat. Kiriel ist ein Ritter, Waffenmeister des Königs Garantiel von Anoroer, aber er ist nicht von Adel. Der König indes lässt ihm eine große Ehre zuteil werden. Er will Kiriel mit seiner Tochter verheiraten. Am Tag der Hochzeit spricht Kiriel bei seinem Freund Delorn vor. Unter einem Vorwand lockt er den Freund auf die königliche Burg, denn er braucht noch einen Trauzeugen.
Die Zeiten haben sich geändert und es besteht für die Menschen keinerlei Veranlassung mehr mit Hochmut ihren Weg zu beschreiten. Nach ihrer verhängnisvollen Niederlage gegen die Drekkars und die Drachen blieb es lange Zeit still. Einzig der Zwist untereinander zerriss den Frieden. Doch nun naht eine neuerliche Zeitenwende, die niemand vorhergesehen hat. Kiriel ist ein Ritter, Waffenmeister des Königs Garantiel von Anoroer, aber er ist nicht von Adel. Der König indes lässt ihm eine große Ehre zuteil werden. Er will Kiriel mit seiner Tochter verheiraten. Am Tag der Hochzeit spricht Kiriel bei seinem Freund Delorn vor. Unter einem Vorwand lockt er den Freund auf die königliche Burg, denn er braucht noch einen Trauzeugen.
Die Hochzeit steht unter keinem guten Stern. Im Reich brodelt es. Waffenlieferungen werden abgefangen. Immer wieder dreist zuschlagende Räuber erschweren die Herrschaft des Königs. Kiriel gerät in eine Gesellschaft, die seiner zwar nicht adligen so doch edlen Gesinnung zuwider läuft. Die ihm versprochene Prinzessin Lerine ist in wilder Leidenschaft entbrannt, allerdings gilt diese ihrem Bruder Tarquain. Die Ehe kommt einerseits ungelegen, andererseits auch willkommen, denn ein aus einem geschwisterlichen Verhältnis entstammender Bastard würde einen Skandal verursachen. Was wäre besser, als das Kind jemand anderem unterzuschieben.
Kiriel weiß zu seinem eigenen Wohl von all dem nichts. Kurz darauf verlässt er mit seiner Braut die königliche Burg, ohne zu ahnen, dass sein Schicksal ihn auf das Furchtbarste prüfen wird.
Eine neue Fantasy-Welt, eine große und sehr fein ausgearbeitete Welt erschließt sich dem Leser mit dem Auftakt der Reihe Söldner. Wir befinden uns im Anschluss großer Umwälzungen in der örtlichen Geschichte. Einst standen Menschen und Riesen Seite an Seite gegen Drachen und Drekkars. Letztere sind mythologisch aus der Vereinigung von Mensch und Drache entstanden.
Die Zeiten der Kämpfe, insbesondere jener berühmten Schlacht zwischen den beiden verfeindeten Seiten, sind lange vorüber. Seither halten die Drekkars einen wichtigen Verbindungspass. Und seither gibt es auch keine Riesen mehr, denn sie starben alle durch einen feigen Hinterhalt der Drachen.
Fabrice David entführt den Leser erst nach einer Einführung in diese ähnliche und doch fremde Welt. Der Auszug des Liedes von Afenor erinnert an Lieder, wie sie irdisch auch in Form des Roland-Liedes zu finden sind. Derlei reale Vorlagenformen werden in Fantasy-Abenteuer gerne aufgegriffen und zur Ausschmückung einer Hintergrundgeschichte genutzt. Aber die Bearbeitung dieses Hintergrundes geht noch weiter. Neben dem Text ist hier die Optik außerordentlich wichtig. Kartenmaterial liefert einen wirklich wunderschönen Überblick über die Ländereien. Die Landschaften wie auch die Gebäude und die Kulissen sind toll gestaltet. Sehr urwüchsig und gebirgig fühlt man sich sofort in alpenländische Regionen versetzt, vielleicht auch in die Nähe der Pyrenäen.
Söldner führen Krieg. In einem mittelalterlich angesiedelten Ambiente kommen wunderbar und aufwändig gezeichnete Rüstungen und Waffen zum Einsatz. Eric Bourgier, der hier in Personalunion zeichnet und koloriert, legt einen ungeheuren Wert auf die exakte Darstellung der jeweiligen Kampfkleidungen. Besonders reizvoll sind in diesen im höchstem Realismus gezeichneten Bildern die Rüstungen der Drekkars. Beruhen die Kleidungsstücke der Ritter um Kiriel auf europäischen Vorbildern, waren bei den Drekkars eindeutig asiatische, genauer japanische Motive der Hintergrund.
Die Gesichtsmasken der Drekkars imitieren die Fratzen eines Drachen. Ihre unheimliche Wirkung mit den durchblitzenden Augen ist höchst dramatisch und ganz bewusst so in Szene gesetzt. Die ersten Kampfhandlungen sind kurz, aber deshalb nicht weniger erschütternd. Szenisch wird wenig gekämpft, dafür ist die Wirkung umso größer. Das Aufeinandertreffen von Prinz Tarquain mit einem Drachen ist auf einer Doppelseite zu bestaunen und entsprechend beeindruckend vor einer Gebirgskulisse inszeniert.
Farblich bewegt Bourgier in Sepiatönen, hellem und dunklem Braun und all den Zwischentönen. Aquarelliert aufgetragen ergeben sich sehr weiche, beinahe traumartige Eindrücke. An dieser Grenze zum Schwarzweißen entsteht ein altertümlicher Eindruck, der den Blick auf eine vergangene, im wahrsten Sinne des Wortes sagenhafte Epoche verstärkt.
Bourgier zeichnet stilistisch durchaus eigenständig, doch seine Frauen (von denen in der Geschichte recht wenig auftreten) erinnern mit ihren breiten Wangenknochen, den schmal geschlitzten Augen und den stark ausgeprägten Lippen stark an Darstellungen von Hermann oder auch Philippe Francq.
Ein sehr sorgsamer Auftakt einer stimmungsvollen Fantasy-Geschichte, die sich um viel Realismus bemüht. Dieser Ansatz gelingt. Fast könnte man die Geschichte in ihrer Aufmachung als tatsächlich irdische Legende oder Sage verstehen – jedenfalls empfehlen sich die beiden Macher Fabrice David und Eric Bourgier mit dieser Arbeit geradezu dafür. Wer eine sehr behutsam und auch klassisch erzählte Abenteuergeschichte lesen mag, sollte einen Blick riskieren. 🙂
Söldner 1 – Das Lied von Anoroer: Bei Amazon bestellen
Dienstag, 03. Februar 2009
 Laith ist ein Findelkind. Dort, wo sein Ziehvater ihn fand, war nur noch der Leichnam seiner toten Mutter. Kein natürlicher Vater erhob Anspruch auf das Kind. So wuchs Laith behütet auf, mit Spielkameraden und Freunden an seiner Seite. Alles wäre gut, hätte Laith nicht diese Fähigkeit, die ihn von anderen abgrenzt. Eine Fähigkeit, die bei anderen Begehrlichkeiten weckt. Bald schon ist das Dorf von Laith in höchster Gefahr. Der Überfall kommt schnell. Laiths Vater befiehlt seinem Sohn die Flucht, diese bleibt jedoch nicht unbemerkt. Kurz darauf muss der Junge sich im Kampf auf Leben und Tod bewähren.
Laith ist ein Findelkind. Dort, wo sein Ziehvater ihn fand, war nur noch der Leichnam seiner toten Mutter. Kein natürlicher Vater erhob Anspruch auf das Kind. So wuchs Laith behütet auf, mit Spielkameraden und Freunden an seiner Seite. Alles wäre gut, hätte Laith nicht diese Fähigkeit, die ihn von anderen abgrenzt. Eine Fähigkeit, die bei anderen Begehrlichkeiten weckt. Bald schon ist das Dorf von Laith in höchster Gefahr. Der Überfall kommt schnell. Laiths Vater befiehlt seinem Sohn die Flucht, diese bleibt jedoch nicht unbemerkt. Kurz darauf muss der Junge sich im Kampf auf Leben und Tod bewähren.
Der Magister Finrhas und sein Gehilfe Dalon erreichen den Schauplatz des Überfalls wenig später, aber zu spät. Die Erwachsenen des Dorfes sind tot, die Kinder verschwunden. Verantwortlich ist der Minister Algärd aus dem Stadt Frätt in der Republik Eponym. Seine Männer haben die Kinder entführt – nur Laith fanden sie nicht. König Bronthe, vom Magister Finrhas herbeigerufen, kann den Eindringling uns seine Soldaten stellen. Die Kinder haben einmal mehr Glück und können auch ihren Rettern entkommen. An Bord des Luftschiffes, das sie fortträgt, stoßen sie wieder auf Laith. Die Kinder sind endlich wieder vereint.
Kind des Blitzes, hier der vorliegende 2. Band, dürfte mit zu den stimmungsvollsten und auch liebenswertesten Produktionen der letzten Zeit gehören. An vorderster Stelle stehen die Figuren, Wesen optisch eine Mixtur aus Katze, Elf und vielleicht Vampir. Zusammengesetzt, wie es ein Disney-Produktion machen würde, mit einer Fantasie erzählt, als hätten sich klassische Fantasy-Autoren mit einem Jules Verne zusammen an einen Tisch gesetzt und Ideen ausgebrütet.
Sicherlich haben Manuel Bichebois (Autor) und Didier Poli (Zeichner) das Rad nicht komplett neu erfunden. Die Herleitung eines Vergleichs zeigt es. Aber Bichebois und Poli nahmen das Beste und fügten darüber hinaus sehr gute eigene Ideen hinzu. Ihre eigens von ihnen geschaffene Welt wirkt sehr organisch, echt. Es ist bestimmt auch schöner, wenn man als Leser den spannenden ersten Teil gelesen hat, aber die Geschichte ist derart aufgebaut, dass es nicht erforderlich ist. Der Überfall auf das Dorf ist ein passender Einstieg. Laiths Fähigkeiten – oder eher der Fluch, wie Laith diese Fähigkeit selbst auffasst – werden schnell genug offenbar, um das Interesse der verschiedenen Gruppen an seiner Person zu erklären.
Als sich Laiths Fähigkeiten richtig zeigen, ist dies für den Leser ein optischer Knaller. Zwar ist die Erstellung all der Effekte mit einem Grafikprogramm leicht erklärbar – dennoch zeitlich aufwendig durchzuführen – aber das ändert nichts an den opulenten Eindruck, den diese Szene hinterlässt. Vor einem gewitterschwarzen Himmel reißt ein weißgrüner, leicht unscharfer Blitz doppelseitig den Hintergrund auf. Im Vordergrund krümmt und quält sich Laith, der von seiner Kraft übermannt wird und am Ende die Kontrolle über sie verliert. Ein Grafiker mag – unabhängig von den zeichnerischen Qualitäten Polis – über die Effekte lächeln, weil er genau weiß, wie diese entstanden sind, aber man manchmal mag man sich einfach nur zurücklehnen und genießen. In vielerlei Hinsicht wurde Wert auf eine zeichentrickähnliche Atmosphäre gelegt und das Erreichen derselben wird spätestens mit dieser Szene ersichtlich.
Alsbald müssen die politischen Ereignisse zurückstehen – man fühlt sich ein wenig an Szenarien wie Der Gefangene von Zenda erinnert – und Laith und seine Freunde stehen mehr im Vordergrund.
Nach der Flucht, insgesamt sehr aufregend und mit glücklichem Ausgang, finden sich die Kinder in einer Umgebung wieder, die in Anlehnung an Die Drachenjäger entstanden sein könnte. Die fliegenden Inseln von Vuenthal erzielen auch hier den gewünschten Effekt. Vertrautheit und Andersartigkeit dieses Gedankenblitzes funktionierten auch schon in Telos (dort wurde die fliegende Stadt allerdings an den Boden gekettet). Ganz kurz werden auch hier die Farben fröhlicher, es grünt, es blüht, bevor die Düsternis die Handlung wieder einholt, da Laith noch eine Aufgabe zu erfüllen hat.
Eine sehr schöne Fantasy-Abenteuergeschichte, der man als Leser inhaltlich wie optisch das liebevolle Herangehen der beiden Macher Manuel Bichebois und Didier Poli auf jeder Seite anmerkt. Klasse. 🙂
Kind des Blitzes 2 – Wo sich die Winde kreuzen: Bei Amazon bestellen
Montag, 02. Februar 2009
 Die Witwe Königin Victoria herrscht über das britische Königreich. Ein Schattenriss ist sie nur. Als ein Schatten von Macht beobachtet sie und fordert zum Handeln auf. Der Respekt ihres Volkes ist ihr sicher. Als Abbild nicht nur der Monarchie, sondern des Empires schlechthin, gehorcht man, wenn die Königin befiehlt. Eines Tages leistet sich ein Mitglied der königlichen Familie einen Fehltritt. Ein Fehltritt darf nicht sein und schon gar nicht mit einer Bürgerlichen. Eine Heirat mit einer solchen Person darf erst recht nicht sein. Beweise sind schnell beseitigt. Fortan lebt Annie, die Bürgerliche, in geistiger Umnachtung in einem Hospital.
Die Witwe Königin Victoria herrscht über das britische Königreich. Ein Schattenriss ist sie nur. Als ein Schatten von Macht beobachtet sie und fordert zum Handeln auf. Der Respekt ihres Volkes ist ihr sicher. Als Abbild nicht nur der Monarchie, sondern des Empires schlechthin, gehorcht man, wenn die Königin befiehlt. Eines Tages leistet sich ein Mitglied der königlichen Familie einen Fehltritt. Ein Fehltritt darf nicht sein und schon gar nicht mit einer Bürgerlichen. Eine Heirat mit einer solchen Person darf erst recht nicht sein. Beweise sind schnell beseitigt. Fortan lebt Annie, die Bürgerliche, in geistiger Umnachtung in einem Hospital.
Albert Victor, der zweite in der Reihe der königlichen Thronfolger, genoss das Leben in der Gesellschaft des Künstlers Walter Sickert. Er genoss es zu sehr und zu sorglos. Sein Wunsch nach einem normalen Leben stürzte eine Frau ins Unglück. Nachdem die Türen des Hospitals sich hinter seiner ihm angetrauten Annie geschlossen hatten, glaubte man das Problem erledigt. Man täuschte sich. Ein Brief taucht bei Walter Sickert auf. 10 Pfund sollen das Schweigen vierer Frauen erkaufen, die mehr wissen, als gut für sie ist. Ihre Majestät ruft den Arzt Sir William Gull. Nachdem er bereits bei Annie ohne zu fragen die richtige Behandlung vollführte, hofft die Witwe nun auch auf sein taktvolles und effizientes Vorgehen.
Doch Sir William will nicht nur seine Aufgabe erfüllen, er will ein Zeichen setzen.
Das Mammutwerk From Hell, geschrieben von Alan Moore ist kein Comic, es ist ein Roman. Zeichner Eddie Campbell wird diese Aussage vielleicht nicht gerne hören, aber seine sind wie Fragmente, Grafiksplitter, jene Bilder, die schnell und filmartig bei dem Leser eines Romans entstehen.
Doch zurück zum Anfang. Der Fall Jack the Ripper beschäftigt seit weit über hundert Jahren die Gemüter. Im ausgehenden Sommer und Herbst des Jahres 1888 wurden (anscheinend) fünf Prostituierte in London von ein und demselben Täter getötet. Vier der Opfer wurden bestialisch zugerichtet. Aus diesem Grund setzte sich der Spitzname des Mörders durch: Jack, der Schlitzer. Lassen wir einmal die historischen Fakten außer Acht – sofern von Fakten überhaupt gesprochen werden kann, denn der Fall weist derart viele Ungereimtheiten auf, dass sein Aufbauschen zu einer derart mysteriösen Angelegenheit kein Wunder ist. Ein Täter, der über die wirklichen Umstände hätte aufklären können, wurde jedenfalls nie gefasst.
Alan Moore hat sich des Stoffes angenommen und erzählt nicht nur einen monströsen Kriminalfall, er seziert auch den Niedergang einer Kultur, eines Königreichs, dessen Machtverlust vorprogrammiert war. Moore entwirft eine Gesellschaft, die unter ihrem eigenen Glanz und Gloria zusammenbricht, weil sie die Zeitenwende zwar nicht verpasst, aber so doch zwanghaft hinauszuschieben versucht. Anders ausgedrückt könnte man schlicht sagen: Außen Hui, innen Pfui!
Moore folgt einer Theorie und greift mit dieser eine populär gewordene Verschwörungsgeschichte auf, hinter der sich zu Beginn nichts anderes verbirgt, als den Fehltritt eines potentiellen Thronanwärters zu vertuschen. Albert Victor, Enkel von Königin Victoria, galt als Lebemann und soll nicht gerade den Vorstellungen eines möglichen Königs entsprochen haben – heutzutage vermutlich auch nicht. Sir William Gull, Arzt, Intellektueller, höchstwahrscheinlich auch Freimaurer, war königlicher Leibarzt und wurde von Königin Victoria persönlich beauftragt, die Beweise, die auf einen Skandal innerhalb der englischen Monarchie hindeuten, aus der Welt zu schaffen. Im Klartext bedeutet das hier: Töten.
Eine tote Prostituierte, auch mehrere hätte wohl kaum jemanden hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorgelockt. Aber Moore inszeniert Gull als Person, die ein Zeichen setzen will.
Wenn Ihr meint, beauftragt einen Komplizen, der mit dieser Art Personen und ihrem Umfeld vertrauter ist. Wir überlassen die Einzelheiten Euch, Sir William. Wir wünschten, es wäre schon getan, und gut getan.
Zum Zeitpunkt der Morde bereits über 70 Jahre alt, holt sich Gull einen Helfer, der in alles eingeweiht ist: den Kutscher Netley. Gulls Einweisung seines Kumpanen gehört zu einer der besten Sequenzen der Handlung. Die Geschichtsträchtigkeit Londons, von der die wenigsten wissen, die auf seinen Straßen flanieren und umher irren, wirkt erschlagend, muffig, verstaubt, auch teuflisch, wie so manche Symbolik immer wieder herzuleiten versucht.
Vor all den Zeichen, die quer über London hinterlassen worden sind, ist es nur recht und billig, wenn ein neues Zeichen alle anderen in den Schatten stellt.
Trauben, mit einem Betäubungsmittel versehen, werden zur Verlockung und kleine Accessoires, die einer Dame gut zu Gesicht stehen, markieren das Ziel. Gull weidet seine Opfer aus, flüchtet in die Vergeistigung seiner Taten, erhöht sie zu etwas, in dem sich sein England widerspiegelt.
In vielen Szenen, die Alan Moore entwirft, zeigt sich sein Talent als sehr guter, mitunter auch als genialer Erzähler. Aber Moore braucht Platz, Raum zur Entfaltung, denn eine Figur wie Gull kommt nicht allein daher. Sie ist nur ein Repräsentant dieser Zeit, einer Zeit, die zerbricht. Am Ende zerbrechen viele der verwendeten Charaktere, so auch der ermittelnde Chefinspektor Abberline von Scotland Yard.
Eddi Campbell, Zeichner dieses Epos’, wirft seine Bilder auf das Papier. In strengen Tuschezeichnungen, mal zerbrechlich, auch bereits gebrochen, dann fest, beinahe klumpig zu nennen breitet sich die Geschichte Seite für Seite aus. Nur ganz selten drängen sich weiche, friedfertige aquarellartige Zeichnungen dazwischen. Campbell kann mehr, als nur in diesen Zeichnungen zu sehen ist. Manchmal blinzelt sein Können durch. Aber er nimmt sich zurück. Es ist fraglich, ob die Geschichte in einer ausgefeilten Hochglanzoptik noch einen derartigen Eindruck hinterlassen könnte. So hat der Leser noch die Möglichkeit, sich hinter den Schleier der Skizzenhaftigkeit der Bilder zurückzuziehen und Abstand zu halten – etwas, das im Verlauf der Handlung immer schwerer fällt.
Ich habe eine Erscheinung gehabt, einen schrecklichen Traum.
Im August 1888 vollziehen Klara und ihr Ehemann Alois in Braunau, Österreich, den Beischlaf. Währenddessen, so schiebt es Alan Moore hier als kleine Episode ein, hat Klara einen furchtbaren Alptraum von Blutfontänen, die aus einer Kirchentür schießen und Juden hinfort spülen.
Zeitgleich besucht Sir William Gull den Elefantenmenschen, Mr. Merrick, der aus Sir Williams Sicht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hindugott Ganesha aufweist. Gull bittet Merrick, immer ruhig zu schlafen, da ein unruhiger Schlaf des Ganesha als Zeichen eines aufziehenden Krieges gedeutet werde.
Kurz darauf beginnt Sir William sein furchtbares Werk.
Schon Roald Dahl zog in seiner Geschichte Genesis und Apokalypse die Hitlers als Instrument bitterböser Satire heran. Auch Moore verwendet sie als Zeichen, wie aus Fleischeslust etwas abgrundtief Böses entsteht. Gleichzeitig sind sie ein Fanal, denn auch aus Sir Williams Arbeit wird eine Form von Fleischeslust, wenn auch eine in höchstem Maße pervertierte. Wenn Moore seinen Sir William dies erkennen lässt, ist es einer der Höhepunkte des Romans.
So lassen sich aus einigen wenigen Szenen bereits Deutungen ziehen. Mooere reiht dergleichen wie auf einer Perlenschnur aneinander. Campbell macht daraus schwarze Perlen, nicht ein-, sondern mehrdeutig, etwas verschwommen, aber von Seite zu Seite faszinierender wie auch furchtbarer werdend. From Hell ist keine leichte Unterhaltungskost. Es ist gruselig, spannend, hintersinnig, vielschichtig und kann reizen, sich ausführlicher mit dieser Zeitperiode zu befassen. 🙂
From Hell: Bei Amazon bestellen
Nachtrag: Wegen des Umfangs dieses Werks fiel die Besprechung etwas länger als gewöhnlich aus.
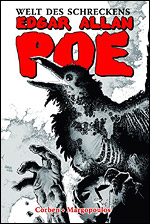 Der Priester hat seine Arbeit vollbracht. Die Schläferin, die Vampirin, die nächtens die Lebenden terrorisierte, ist nun endgültig tot. Ihr Kopf wurde vom Rumpf getrennt, wie es für die Vernichtung eines Vampirs vorgeschrieben ist. Aber der Priester hat ihren Meister vergessen, den, der die Schläferin erschaffen hat. Kurz darauf schlagen sich messerscharfe Zähne in den Hals des Priesters, der panisch reagiert und mit seinem Kreuz zusticht. In dieser Welt des Schreckens sind Vampire allerdings noch das kleinste Übel. Viel schlimmer ist der Mensch, der mordet und meuchelt und der dennoch immer wieder auf das Fürchterlichste lächelt.
Der Priester hat seine Arbeit vollbracht. Die Schläferin, die Vampirin, die nächtens die Lebenden terrorisierte, ist nun endgültig tot. Ihr Kopf wurde vom Rumpf getrennt, wie es für die Vernichtung eines Vampirs vorgeschrieben ist. Aber der Priester hat ihren Meister vergessen, den, der die Schläferin erschaffen hat. Kurz darauf schlagen sich messerscharfe Zähne in den Hals des Priesters, der panisch reagiert und mit seinem Kreuz zusticht. In dieser Welt des Schreckens sind Vampire allerdings noch das kleinste Übel. Viel schlimmer ist der Mensch, der mordet und meuchelt und der dennoch immer wieder auf das Fürchterlichste lächelt.




















 Der Planet Kiros wollte den Krieg nicht. Er bekam ihn trotzdem. Kiurz nachdem der örtliche Gouverneur mit Yoda über die Hilflosigkeit seines Volkes in diesem Konflikt gesprochen hat, landet Count Dooku mit seinen Droideneinheiten. Unter der Vorspiegelung einer friedlichen Besetzung Kiros’ will er ein Bollwerk gegen die vorrückenden republikanischen Einheiten schaffen. 19 Umkreisungen später ist der Krieg auch auf Kiros in vollem Gange. Der Versuch, eine Neutralität zu wahren, hat nichts genützt. Geradezu spielerisch gehen die Klontruppen gegen die Droiden vor. Sie vergeben sich gegenseitig Punkte für Abschüsse. Wie ernst die Lage wirklich ist, erfahren sie durch den Erhalt einer Bombendrohung.
Der Planet Kiros wollte den Krieg nicht. Er bekam ihn trotzdem. Kiurz nachdem der örtliche Gouverneur mit Yoda über die Hilflosigkeit seines Volkes in diesem Konflikt gesprochen hat, landet Count Dooku mit seinen Droideneinheiten. Unter der Vorspiegelung einer friedlichen Besetzung Kiros’ will er ein Bollwerk gegen die vorrückenden republikanischen Einheiten schaffen. 19 Umkreisungen später ist der Krieg auch auf Kiros in vollem Gange. Der Versuch, eine Neutralität zu wahren, hat nichts genützt. Geradezu spielerisch gehen die Klontruppen gegen die Droiden vor. Sie vergeben sich gegenseitig Punkte für Abschüsse. Wie ernst die Lage wirklich ist, erfahren sie durch den Erhalt einer Bombendrohung.
 Spider-Man ist der Star im Ring. Keiner der anderen Wrestler kann ihm das Wasser reichen. Der junge Peter Parker glaubt nicht, dass es noch besser werden kann. Er hat Geld und Anerkennung. Das Publikum liebt ihn. – Aber das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war Peter Parker, der Junge hinter der roten Maske mit der dunklen Augenumrandung einer der größten Verlierer seiner Schule. Immer musste er als Prügelknabe herhalten. Besonders Flash Thompson machte ihm das Leben schwer. Bis die Spinne kam. Dann änderte sich alles. Beinahe jedenfalls.
Spider-Man ist der Star im Ring. Keiner der anderen Wrestler kann ihm das Wasser reichen. Der junge Peter Parker glaubt nicht, dass es noch besser werden kann. Er hat Geld und Anerkennung. Das Publikum liebt ihn. – Aber das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war Peter Parker, der Junge hinter der roten Maske mit der dunklen Augenumrandung einer der größten Verlierer seiner Schule. Immer musste er als Prügelknabe herhalten. Besonders Flash Thompson machte ihm das Leben schwer. Bis die Spinne kam. Dann änderte sich alles. Beinahe jedenfalls.

