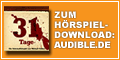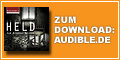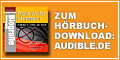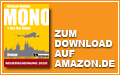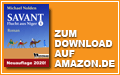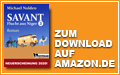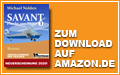Schon wieder nicht gewonnen! Und wer trägt die Schuld dafür? Homer, wer sonst. Aber das spielt für Homer auch keine Rolle, denn der Spaß am Bowling kommt nicht vom Bowling, sondern vom Bier.
Schon wieder nicht gewonnen! Und wer trägt die Schuld dafür? Homer, wer sonst. Aber das spielt für Homer auch keine Rolle, denn der Spaß am Bowling kommt nicht vom Bowling, sondern vom Bier.
Nur leider findet sein Team einen Ersatz für ihn, jemanden, der tatsächlich bowlen kann. Und plötzlich ist Homer allein, allein draußen auf der Straße, während seine Freunde in der Kneipe feiern – nur Spieler sind zur Feier eingelassen. Für Homer wird keine Ausnahme gemacht.
Wie lautet die beliebte Sportart des Durchschnittsamerikaners, gleich auf dem dritten Platz nach American Football und Baseball? BOWLING!
Richtig. Gerne wird in Fernsehserien oder auch Kinofilmen (siehe: The Big Lebowski, Kingpin) gezeigt, wie der gemeine Amerikaner, der ansonsten gar nichts kann, diesen Sport zu höchsten Höhen erhebt, weil er hier seine Erfolgserlebnisse hat (siehe: Al Bundy). Homer Simpson gehört zu einer ganz besonderen Fraktion – denn er kann selbst das nicht.
Ian Boothby schickt den gelbsten Helden mit dem dicken Bauch und dem schütteren Haar auf eine ganz eigene Tour De Force. Nimm einem Mann seinen Sport, seine Gruppe, in der er sein darf, wie er ist. Was hat er dann noch?
Jedenfalls verliert Homer über all dem nicht seinen Appetit.
Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder, Mom?
Für Homer schon, denn die Art und Weise, wie er eine Ersatzsportart findet und neue Freunde gleich dazu – ausgerechnet jene, die seinen Sohn Bart sonst verhauen – Streetbowling ist ein würdiger Ersatz, weil Homer es hier endlich allen zeigen kann. Na, wenigstens denen, die den Mumm haben, die Straße zu überqueren oder auf dem Bürgersteig lang zu gehen.
Boothby zelebriert an Homers Beispiel einmal mehr die Rache des kleinen Mannes. Da werden Passanten vom Bürgersteig gekickt, dass es nur so kracht. Homer wirft einen Strike nach dem anderen, was hier nichts anderes bedeutet, als einen Passanten so umzuwerfen, so dass er mit dem Kopf auf dem Boden landet.
So weit, so sportlich.
Weniger sportlich, als vielmehr künstlerisch – und hier wechselt Boothby die Sphären – geht es im Erzählteil um Bart zu, der mit seinen Graffitis die gesamte Stadt terrorisiert. Unter dem wenig einfallsreichen Pseudonym El Barto hat es Bart zu einiger Berühmtheit gebracht. Und ähnlich wie echte Sprayer werden auch seine Werke künstlerisch wertvoll. Leider …
Das soll nicht verraten werden, doch auch dieser Schuss geht nach hinten los und so schließt Ian Boothby den Kreis auf elegante Weise.
Homer und Bart, sehr menschlich dargestellt, werden hier von ihren Gewissen und ihrem Zugehörigkeitswunsch eingeholt. Bei all dem Unsinn, den sie ansonsten anstellen, bleiben sie so liebenswert – na, wenigstens sympathisch.
Wer als Leser diesmal genau hinliest wird Anspielungen auf Monk und die Blue Man Group entdecken. Das amerikanische Rechtssystem bleibt nicht außen vor, jenem, in dem sich schon Kinder vor Gericht wieder finden. Herrlich schräg, wunderbar gemein und politisch unkorrekt.
Außerdem kann, wer Boothby und seine Frau, die Zeichnerin Pia Guerra, live in Deutschland verpasst hat, sich im Anhang ein Bild von seinen Signierstunden auf der Leipziger Buchmesse 2008 machen. 🙂