Freitag, 10. Oktober 2008
 Die Frau soll ihm nicht entkommen. Das wäre ja auch gelacht. Auf dem Pier haben die Gangster und ihre Anführerin keine Fluchtmöglichkeiten. Aber Madame X will gar nicht entkommen. Ihr Plan ist nicht sehr ausgefeilt. Sie will ledglich ganz Gotham City vergiften. Wenn dabei auch noch Batman eine Dosis abbekommt, umso besser. Eben konnten die Leser noch die neue Spirit-Variante von Darwyn Cooke ins Auge fassen und schon kehrt er unter der Regie von Paul Grist zu seinen Wurzeln zurück. Wie schon in anderen Situationen muss Batman den Einfluss von Drogen auf sein Gehirn bekämpfen.
Die Frau soll ihm nicht entkommen. Das wäre ja auch gelacht. Auf dem Pier haben die Gangster und ihre Anführerin keine Fluchtmöglichkeiten. Aber Madame X will gar nicht entkommen. Ihr Plan ist nicht sehr ausgefeilt. Sie will ledglich ganz Gotham City vergiften. Wenn dabei auch noch Batman eine Dosis abbekommt, umso besser. Eben konnten die Leser noch die neue Spirit-Variante von Darwyn Cooke ins Auge fassen und schon kehrt er unter der Regie von Paul Grist zu seinen Wurzeln zurück. Wie schon in anderen Situationen muss Batman den Einfluss von Drogen auf sein Gehirn bekämpfen.
Gleich in der zweiten Geschichte, Schauermärchen, begegnet der Leser einem Zeichner, der besonders als Zeichner der Fantastischen Vier viel geleistet hat und in der Lage war, sehr sympathische Figuren zu schaffen: Mike Wieringo, leider 2007 viel zu früh verstorben, arbeitet hier mit dem sehr guten Inker Karl Story zusammen. Todd Dezago schrieb eine Geschichte, in der Batman noch eine Legende ist, ein dunkles Schemen, ein Gerücht – und dies auch bleiben will.
Gleich darauf geht Alan Davis, ebenfalls ein Veteran aus dem Marvel-Universum, mit seinen Bildern zu Batman an den Start. Auf das Feinster getuscht von Mark Farmer erleben wir eine alte Geheimidentität von Batman in Aktion. Dies ist ein Batman, der stark an die alten Klassiker von Neal Adams erinnert.
Nach zwei eher mit sehr feinen Linien gezeichneten Geschichten wird auch wieder gröber. Manchmal scheint mit dicken Strichen gearbeitet worden zu sein, unter der Zuhilfenahme von Rasterfolien. Ein anderes Mal, wie im Falle von Denys Cowan, scheint der Leser es mit einer künstlerischen Mischung aus Frank Miller und Eduardo Risso zu tun zu haben.
Teilweise, wie im Falle von Zeichner Danijel Zezelj, sind die Bilder wie in Stein gemeißelt. Auch sind solche Geschichten düsterer und härter. Wenn vor Batman eine skelettierte Hand aus dem Boden ragt und Gotham wie eine verschachtelt wirkende Katakombe von oben betrachtet werden kann, dann kommt hier die Atmosphäre eines Batmans der aktuell letzten beiden Verfilmungen heraus.
Alles ist möglich. So facettenreich wie die erste Sammlung der Schwarzweißgeschichten um Batman präsentiert sich auch der zweite Band. Spätestens bei Bildern von Scott Morse, dessen Grafiken an Gregory erinnern, wird dies allzu deutlich. Brent Anderson erweckt mit seinen Bildern die 50er Jahre zum Leben. Die nostalgischen Gefühle eines Superhelden könnten kaum besser in Szene gesetzt werden.
Die Vielfältigkeit der Geschichten und somit die Vielzahl der Seiten einer einzigen Figur ist erstaunlich. Es ist auch im Verlassen von alten Bahnen begründet, dass diese viele Interpretationen so gut funktionieren und als Detektiv- wie auch Rächergeschichten für jedermann funktionieren – besonders auch für jene, die keinerlei Ahnung von Batman haben. Auf den Einsatz altbekannter Gegner wird weitestgehend verzichtet. Die Auftritte von Riddler, Scarecrow oder Harley Quinn fallen kaum ins Gewicht.
Ein heimlicher Nebendarsteller, ohne den hier nichts geht, ist Gotham City. Wie sehr diese Stadt in den Mittelpunkt rücken kann – ähnlich wie das allseits beliebte Metropolis – zeigt hier die Gotham Sonntagsreportage, die aus illustriertem Text besteht, der wie ein Wegweiser durch Gotham gelesen werden möchte. Wer einmal ganz genau durch den Band blättert und sich die verschiedenen Interpretationen dieser Stadt ansieht, erhält gleichzeitig auch einen guten Eindruck, wie künstlerisch auch ein Mainstream-Comic sein kann.
Ein einziges Mal ist hier Farbe im Spiel. Rot wie Blut natürlich. In der Geschichte Das Gaswerk hat Hellboy-Vater Mike Mignola den Text geschrieben. Troy Nixey imitiert den grafischen Stil des ebenfalls bekannten Grafikers derart, dass man sich als Mignola-Fan direkt zuhause fühlt. Die hier eingeschlagene Horrorlinie wird auch sogleich in der folgenden Geschichte Furcht ist der Schlüssel fortgesetzt, so dass auch dieses Genre abgehandelt wird.
Ein weiterer Querschnitt durch das Batman-Universum – das locker ohne all die anderen Helden bestehen kann – mit vielen Gesichtspunkten, die auch über die Interpretationen des ersten Sammelbandes hinausgehen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Spannungserzeugung. Wer auch einmal lachen möchte, liegt hier falsch. Batman ist ein Detektiv mit zum Teil wahnsinnigen Fällen, wie er hier eindrucksvoll unter Beweis stellt – textlich wie optisch. 🙂
Batman – Schwarz-Weiß Collection 2: Bei Amazon bestellen
Kommentare deaktiviert für Batman – Schwarz-Weiss Collection 2
Mittwoch, 08. Oktober 2008
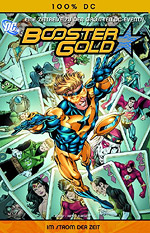 Booster Gold gehört nicht zu den beliebtesten Helden im Universum. Ihm haftet ein schlechtes Image an, weil er stets etwas egoistisch an diverse Angelegenheiten herangegangen ist. Der Mietheld aus der Zukunft konnte mit seinem strahlenden Lächeln nie so recht landen – bei den anderen, echten Helden nicht und bei den normalen Menschen auch nicht. Das soll nun anders werden. Booster ist kein schlechter Kerl. Immerhin stürzt er sich ohne ein Zögern auf Gauner und Halunken. Allerdings auch ohne großartig über sein Handeln nachzudenken. Aber auch ein neuerlicher Sieg über die Royal Flush Gang kann die JLA nicht davon überzeugen, ihn in ihre Reihen aufzunehmen.
Booster Gold gehört nicht zu den beliebtesten Helden im Universum. Ihm haftet ein schlechtes Image an, weil er stets etwas egoistisch an diverse Angelegenheiten herangegangen ist. Der Mietheld aus der Zukunft konnte mit seinem strahlenden Lächeln nie so recht landen – bei den anderen, echten Helden nicht und bei den normalen Menschen auch nicht. Das soll nun anders werden. Booster ist kein schlechter Kerl. Immerhin stürzt er sich ohne ein Zögern auf Gauner und Halunken. Allerdings auch ohne großartig über sein Handeln nachzudenken. Aber auch ein neuerlicher Sieg über die Royal Flush Gang kann die JLA nicht davon überzeugen, ihn in ihre Reihen aufzunehmen.
Nach einer weiteren Auseinandersetzung, die eher freundschaftlicher Natur ist, bringt ein Lichtblitz eine neue und gleichzeitig bekannte Figur ins Spiel: Rip Hunter, den Zeitmeister. Nachdem das Multiversum einigermaßen gerettet worden ist, sind einige Restbestände dieser Rettung noch in Unordnung. Kurz: So manches historische Detail ist nicht so, wie es Kenntnis der Geschichte sein sollte. Booster soll helfen, diese Angelegenheiten wieder ins Lot zu bringen.
Deshalb bist du der perfekte Mann für diese Mission. Jeder glaubt bereits, du seiest ein Idiot.
Booster Gold ist mit eigener Serie unterwegs in der Zeit, hin zu den größten DC-Events. Sein Schöpfer, Dan Jurgens, hat den Zeichenstift übernommen und überlässt die Handlung den beiden Autoren Geoff Johns und Jeff Katz.
Geoff Johns und Jeff Katz reihen sich mit ihren Geschichten über alternative Realitäten innerhalb des DC-Universums in eine längere Reihe von Handlungen dieser Art ein. Beide nutzen die Gelegenheit, damit ein paar Charaktere sich in neue Situationen einfinden können, von denen bestimmte Varianten sogar recht reizvoll sind.
Sinestro hat in der letzten Zeit recht viele Schwierigkeiten bereitet, das Green Lantern Corps kann ein Lied davon singen. Booster muss verhindern, dass sich ausgerechnet jene Ereignisse allzu früh in der Geschichte abspielen. Das Ergebnis ist … Sagen wir, es ist mit einer Lösung verknüpft, wie sie nur einem Booster einfallen kann. Immerhin, und das ist ausgesprochen löblich, ist Gewalt hier einmal nicht der Weg.
Und was hätte geschehen können, wenn nicht ein Ehepaar namens Kent den kleinen Superman gefunden hätten, sondern ein Geschäftsmann namens Lionel Luthor? Was wäre, wenn der Joker nicht auf Barbara Gordon geschossen hätte? Was wäre, würde der Blue Beetle, Boosters bester Freund, noch leben würde?
Johns und Katz belassen es nicht einfach nur bei der Problemlösung dieser (comic-)historischen Ereignisse. Das wäre wahrscheinlich für jeden Helden zu einfach – müssen sie geglaubt haben, aber das ist schwer vorstellbar, denn durch zusätzliche Eingriffe von dritter Seite geraten Booster und Rip Hunter zusätzlich unter Druck, sogar unter Zeitdruck, obwohl sie durch die Zeitmaschine hin und her springen können. Aber sie lassen ihre Helden auch nicht allein, sehr zur Freude der Leser, denn dieser kann sich so auf Verstärkung in Form von Barry Allen (Flash) und Wally West (Kid Flash) freuen.
Bei aller Action, die auch in den erwähnten Situationen unvermeidlich ist, setzen Johns und Katz auf Humor. Booster Gold ist als Spaßvogel konzipiert. Szenen, in denen sich Booster mit Jonah Hex, einem Revolverhelden aus der Vergangenheit, betrinkt, sind ein Beispiel für diverse komödiantische Einschübe. Im Gegensatz fehlt es nicht an Dramatik, wenn Booster einen Anschlag nicht verhindern kann und es trotzdem immer und immer wieder versucht.
Bei all dem darf Dan Jurgens nicht vergessen werden, der durch viele, viele gute Bilder schon aufgefallen ist. Qualitativ bewegt er sich auf Augenhöhe mit einem Alan Davis und arbeitete schon an manchen Projekten mit, deren Bekanntheitsgrad größer als gewöhnlich ausfiel. Der Tod von Superman oder Superman vs. Aliens seien hierzu genannt. Dank dem für die Tusche verantwortlichen Norm Rapmund bleiben die klaren feinen Linien und die aufwändige Skizzierung der Bilder von Jurgens erhalten. Immer wieder verschiedene Seitenaufbauten erhöhen die dramatischen Effekte und fordern das Leseverhalten stets neu, so dass rein optisch jeder Langeweile entgegengewirkt wird. Ob in sehr aufgeteilten Seiten oder in ganzseitigen Bildern, Jurgens vernachlässigt nichts und arbeitet so detailreich wie möglich.
Schwächen scheinen seine Werke auch nicht zu kennen. Ob Gesichter, Körperhaltungen, Perspektive oder Ausstattung, alles ist gleich gut gelungen. Da auch die Farbgebung durch Hi-Fi und Lee Loughridge optimal mitspielt, gibt es hier rundum klasse Bilder.
Spaß, Dramatik, Action in Text und Bild, alles passt hier toll zusammen und bietet einen prima Ausflug in das DC-Universum. Obwohl einige Ereignisse aus diesem Universum angeschnitten werden, sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Beste Superhelden-Unterhaltung. 🙂
Dienstag, 07. Oktober 2008
 Batman wollte sich genau in diesem Augenblick einen Verbrecher schnappen – als es ihn schnappte. Auch Superman hatte eigentlich etwas ganz anderes im Sinn, aber plötzlich steht er vor einer Versammlung von Superhelden und seltsamerweise sind viele darunter gleich mehrfach vorhanden – und auch irgendwie nicht. Alle, wie sie da sind, sind Entführungsopfer. Bei manchen der anwesenden Helden ist dies kaum begreiflich, stellen sie doch die mächtigsten Lebewesen dar, die ihre jeweilige Erde zu bieten hat. So ist Superman nicht das einzige Superwesen. Auch Batman ist nicht der einzige dunkle Ritter – und auch er hat sich seine alternativen Identitäten aus Paralleluniversen sicherlich anders vorgestellt.
Batman wollte sich genau in diesem Augenblick einen Verbrecher schnappen – als es ihn schnappte. Auch Superman hatte eigentlich etwas ganz anderes im Sinn, aber plötzlich steht er vor einer Versammlung von Superhelden und seltsamerweise sind viele darunter gleich mehrfach vorhanden – und auch irgendwie nicht. Alle, wie sie da sind, sind Entführungsopfer. Bei manchen der anwesenden Helden ist dies kaum begreiflich, stellen sie doch die mächtigsten Lebewesen dar, die ihre jeweilige Erde zu bieten hat. So ist Superman nicht das einzige Superwesen. Auch Batman ist nicht der einzige dunkle Ritter – und auch er hat sich seine alternativen Identitäten aus Paralleluniversen sicherlich anders vorgestellt.
Kurz darauf stellt sich ihnen auch ihr Gastgeber vor: Monarch. Diese überaus mächtige Kreatur – mächtiger als alle Supermänner des Multiversums zusammen, so gibt er es jedenfalls eindeutig zu verstehen – braucht Verstärkung, denn Monarch hat einen Plan gefasst, der ihm alleine dann doch unlösbar erscheint. Er will die Monitors angreifen. Dazu sollen sich die Helden gegen ihre Alter Egos beweisen und zum Kampf gegen sie antreten. Je zu dritt treffen sie in der Arena aufeinander. Wer siegt, ist im Team, wer verliert, hat sein Leben verwirkt – so oder so.
Vampire sind auch im Superhelden-Genre nichts Neues. Schon Superman hatte mit ihnen zu tun, aber ein vampirischer Batman gibt dem Mitternachts-Detektiv einen ganz neuen Sinn. Willkommen in einer Ansammlung von einigen höchst skurrilen Abwandlungen unserer allseits bekannten und beliebten Superhelden. Wonder-Women, Green Lanterns, Batmen, Supermen …
Keith Champagne hat augenscheinlich seinen Spaß an dieser Arena-Show, wie sie immer wieder einmal in Comics, Zeichentrickfilmen oder SciFi-Geschichten thematisiert wird. Die verschiedenen Identitäten werden von ihm gnadenlos ausgeschlachtet. Die Helden sind einander zumeist sehr unähnlich. Genosse Superman wurde hervorgeholt und tritt einem eher handelsüblichen Superman entgegen. Flashes und Blue Beetles sind manchmal recht merkwürdig. Die Atom-Varianten halten noch einen dusseligen Nazi bereit, der beständig blödes Zeug quatscht und nicht nur den mitspielenden Figuren auf die Nerven geht. Immerhin hat Champagne ein Einsehen und lässt ihn zügig das Spielfeld verlassen.
Die Kämpfe sind martialisch und gemäß neuer Richtlinien – ob nun festgelegt oder nicht – gnadenlos und mörderisch. Hier wird die neue Härte (nun, es gibt sie schon seit einigen Jahren) heftig praktiziert. Wer alleine die Auseinandersetzung der Flash-Varianten liest, erlebt einen Kampf mit Charakteren, die eine ziemliche Menschenverachtung zur Schau tragen. Ach, wie muss das fein sein, einmal richtig Schwein sein, mag sich Champagne gedacht haben und sorgt dafür, dass diese abgedrehten Helden so richtig die Sau rauslassen.
Optisch ist hier Scott McDaniel am Werk, der schon recht viele Erfahrungen mit Batman sammeln konnte und einen eher spartanischen Zeichenstil bevorzugt. Hierzulande sind auch seine Arbeiten zu Superman bei einem Neustart der Reihe schon aufgefallen. Zu jener Zeit – in der auch ein neues Supergirl namens Cir-El auftauchte – wirkten die Zeichnungen im Vergleich zu Arbeiten anderer Künstler manchmal etwas zu einfach. Hier, im vorliegenden Band, hat noch einmal eine Reduktion dieses Zeichenstils stattgefunden, was aber auch am verantwortlichen Inker liegen kann. Die Tendenz geht eindeutig in eine zeichentrickartige Fassung auf Papier, letztlich spricht auch die Rasanz mancher Szene genau dafür. Eine gewisse grafische Verwandtschaft zu Batman Beyond (dt.: Batman of the future) kann nicht geleugnet werden.
Ein langer Prolog in Form vieler Zwei- und Dreikämpfe. Hier geht es um Kampf und Stärke. Ersteres findet fortwährend statt, letzteres wird beständig unter den Akteuren ausgelotet. Wer sich mit der grafischen Form anfreunden mag, wird in der Geschichte von Keith Champagne viele Überraschungen entdecken. 🙂
Mittwoch, 01. Oktober 2008
 Nathan hatte einen furchtbaren Alptraum. Wieder musste miterleben, wie seine Familie getötet wurde. Eines Tages jedoch erhält er die Chance zur Rache. Als er im Krankenhausbett erwacht, ist sein amputiertes Bein wieder da. Aber dennoch: Etwas ist anders. Früher hat ein ganz normales Auftreten auf den Boden keine Fußabdrücke im Beton hinterlassen. Aus einer anfänglichen Panik erwächst sehr bald Gewissheit dank der Hilfe der Justice Society of America. Nathan hat eine flüssige Metalllegierung in seinem Körper aufgenommen, die ihn schützt und neue Kräfte verleiht. Leider hat er diese noch ganz und gar nicht unter Kontrolle. Die JSA schafft mit einem neuen – sehr ungewöhnlichen – Kostüm Abhilfe. Und ob er es will oder nicht: Citizen Steel ist geboren.
Nathan hatte einen furchtbaren Alptraum. Wieder musste miterleben, wie seine Familie getötet wurde. Eines Tages jedoch erhält er die Chance zur Rache. Als er im Krankenhausbett erwacht, ist sein amputiertes Bein wieder da. Aber dennoch: Etwas ist anders. Früher hat ein ganz normales Auftreten auf den Boden keine Fußabdrücke im Beton hinterlassen. Aus einer anfänglichen Panik erwächst sehr bald Gewissheit dank der Hilfe der Justice Society of America. Nathan hat eine flüssige Metalllegierung in seinem Körper aufgenommen, die ihn schützt und neue Kräfte verleiht. Leider hat er diese noch ganz und gar nicht unter Kontrolle. Die JSA schafft mit einem neuen – sehr ungewöhnlichen – Kostüm Abhilfe. Und ob er es will oder nicht: Citizen Steel ist geboren.
Die JSA sucht neue Mitglieder. Die Stammbesatzung kann zwar prächtig aufräumen, wie sie in einem Einsatz gegen Neonazis beweist, die ihren Captain Nazi freipressen wollen. Derweil macht sich Superman immer noch so seine Gedanken darüber, warum Starman hier ist. Der Held aus der Legion der Zukunft ist in der Gegenwart gestrandet. Nach eigener Aussage hat er eine Aufgabe, leider ist er auch geistig verwirrt, was weder seine Aufgabe vereinfacht, noch das Zusammenleben mit Starman.
Starman ist nicht das größte Problem. Damage droht seine Beherrschung zu verlieren, als er Zoom begegnet, der ihn vor einiger Zeit entstellte. Nur ein sehr beherztes und vorsichtiges Eingreifen von Liberty Belle kann schlimmeres verhindern. Und dann ist da noch …
Viel los in der zweiten Ausgabe der JSA mit dem Untertitel KINGDOM COME II! Wer sie, die JSA, noch nicht kennt, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Die Einführung ist recht gelungen. Ein paar Neulinge kommen zu Wort, Liberty Belle und ihr Ehemann Hourman werden genauer vorgestellt. Und schließlich erscheint derjenige, auf den man sich als Leser natürlich freut, wird er doch gleich auf dem Cover gezeigt: Der Superman von Erde 22.
Hört sich merkwürdig an, ist aber so. Das Multiversum ist in sich zusammengebrochen. Auf der übrig gebliebenen Erde kehrt man nun die Reste zusammen. In all den Jahren kann man als Leser sehr gut den Überblick verlieren über all die Ereignisse, die mal dieses oder jenes bewirkt haben. Flash, mit einer Suppenschüssel auf dem Kopf, Green Lantern, frisch beim Fasching eingekleidet oder auch Power Girl, die wohl mit den meisten Muckies gesegnete Helding unter den kryptonischen Frauen. Da ist ein Starman, der aus der Zukunft kam, noch der am wenigsten verwirrende Charakter, denn er ist selbst vollkommen verwirrt. – Harmlos ist er deshalb noch lange nicht.
Verharmlost werden hier mal wieder leichtfertig die Nazis mit ihren Auftritten als Captain Nazi oder auch Reichsmark (dürfte die blödeste Namensgebung für einen Bösewicht in Comics sein). Aber amerikanische, auch frankobelgische Autoren nehmen’s mitunter recht locker, was dieses Thema anbelangt.
Und trotzdem fällt der vorliegende Band nicht durch. Warum? Es sind Ausrutscher, denn die Geschichte fängt sich – nach der Einführung von Citizen Steel – mit einem unheimlichen Feind und einem neuen Freund. Geoff Johns hätte mit diesem Teil eher beginnen sollen und der vorliegende Band wäre perfekt gewesen.
Die Halbgötter sind dran. Nicht solche in weiß, auch nicht Ottonormalheld, sondern jene, die sich den Anschein einer Verwandtschaft zu bekannten Mythologien geben. Der Gegner ist von einer solchen Stärke, dass er in Nullkommanichts mit diesen Möchtegerns aufräumt. Wie in einem Krimi kann sich die JSA nur mit den Funden der Leichen begnügen, bevor sie auch nur einen Schritt hin zur Lösung machen kann. Daneben kommt dieser Besuch eines alten Superman, eines gebrochenen Mannes, der nicht nur seine Familie, seine Freunde, vielmehr eine ganze Welt verloren hat – noch eine. Er ist ein Mann, der mit Neid auf diese Welt schaut, in der alles besser ist, wenigstens die Helden, vielleicht sogar die Bösewichter. Dieser Superman ist zurückhaltend, gebrochen. Geoff Johns lässt diese Figur schnell zwischen den anderen Charakteren aufgehen, bevor er die berühmte Bombe platzen lässt.
Als Zeichner liegen die beiden Dale Eaglesham und Fernando Pasarin auf Augenhöhe zueinander. Zuerst hat Eaglesham eine kleine Schwäche, so wirken seine Bilder gröber als die des später einsetzenden Pasarin, aber das scheint eine Folge der Tuschearbeit zu sein. Im ersten Kapitel noch teilen sich Ruy José und Rodney Ramos diese Arbeit, während sie später jeder für sich allein an den jeweiligen Kapiteln arbeiten. Insgesamt sind die Zeichnungen sehr fein und ausdrucksstark geraten, fast so, als würden Nachfolger von Alan Davis hier am Werk sein. Optisch darf sich der Leser auf eine absolut tolle Arbeit freuen.
Ein Knaller, nicht zuletzt wegen der eingestreuten Cover von Alex Ross, der Superhelden anziehen kann wie kein zweiter. Geoff Johns hat schon mehrfach bewiesen, dass er mit alternativen Heldenwelten umzugehen versteht. Hier setzt er diesen Beweis fort (bis auf den einen Tritt in den Fettnapf). Hinter dem Alltag der Superhelden wächst langsam eine Mischung aus Krimi und Tragödie heran.
Montag, 15. September 2008
 Fast Food ist nicht gut für die Gesundheit. So ein Hot Dog mit allem, Sauerkraut und seltsamen Saucen, besonders wenn sie mit Botox in hoher Konzentration versetzt sind, können dem menschlichen Organismus schon mal den Garaus machen. Tom Ragg ist tot. Was Tom nicht wusste: Er war nur ein Köder. Auf der Gegenseite glaubt man, dass Madame Mirage diesen Köder mit Pauken und Trompeten geschluckt hat, aber jemand, der sich mit Gangstern der übelsten Sorte anlegt, ist nicht so dumm zu glauben, dass sich diese Gangster nicht auch Gegenmaßnahmen überlegen würden.
Fast Food ist nicht gut für die Gesundheit. So ein Hot Dog mit allem, Sauerkraut und seltsamen Saucen, besonders wenn sie mit Botox in hoher Konzentration versetzt sind, können dem menschlichen Organismus schon mal den Garaus machen. Tom Ragg ist tot. Was Tom nicht wusste: Er war nur ein Köder. Auf der Gegenseite glaubt man, dass Madame Mirage diesen Köder mit Pauken und Trompeten geschluckt hat, aber jemand, der sich mit Gangstern der übelsten Sorte anlegt, ist nicht so dumm zu glauben, dass sich diese Gangster nicht auch Gegenmaßnahmen überlegen würden.
Madame Mirages Gegner hat sich einen passenden Namen ausgewählt: MousetrapDer erste Achtungserfolg, den Madame Mirage gegen das Syndikat erzielte, hat die Gangster arg nervös werden lassen. Autor Paul Dini hat eine Schurkenjägerin geschaffen, die keine Gefangenen macht. Der Lockvogel, der ihr vor die Nase gesetzt wird, beißt in seinen Hot Dog, noch voller Genuss, nur um im nächsten Augenblick zu spüren, wie das Botox seine Arbeit macht. Als Mittel zur Gesichtsstraffung durch die Lähmung von Gesichtsmuskeln durchaus beliebt, ist es im Bereich der Atemmuskulatur eher hinderlich.
Für Mirage ist alles ein großes Spiel. Ihr Äußeres ändert sie mit einem Fingerschnippen – jedenfalls in dieser Geschwindigkeit. Man könnte sie als einen modernen Fantomas bezeichnen, nur überaus weiblich und kurvenreich, darüber hinaus auf der richtigen Seite des Gesetzes stehend, dafür aber auch als Richter und Henker in einer Person.
Kenneth Rocafort hat Madame Mirage ein sehr modisches Outfit beschert, laufstegverdächtig gut, knapp geschnitten und mit dem nötigen Dekolleté, das einen richtigen Gangster natürlich nicht lange ablenkt. Das weiß auch Madame, die auch mal ein Double vorschickt und über die Klinge springen lässt. Beide Seiten verwenden ihre Lockvögel. Mirage handelt nach der Prämisse: Mitgefangen, mitgehangen.
Die Bilder sind verhalten brutal. Madame Mirage zieht zwar mit einer Art chirurgischer Präzision zu Felde, aber sobald sie zuschlägt, muss es effektiv sein – was nichts anderes als tödlich bedeutet. Entsprechend fallen die Todesszenen aus, nicht übermäßig blutig, aber sie verheimlichen auch nichts. Der Gegensatz von Brutalität und wunderschönem Jäger macht einen Teil des Reizes der Reihe aus. – Doch wer weiß? Vielleicht ist diese wunderschöne Larve, die Madame präsentiert, auch nur dahergezaubert.
Eine spannende Episode. Es ist aber empfehlenswert, die erste Folge als Einstieg gelesen zu haben, da etwas Grundwissen der Serie Voraussetzung ist. Gangster, Superhelden und Thriller erfreuen sich mit Madame Mirage einer weiteren Variante, die einen zusätzlichen Blickwinkel ins Spiel bringt. Wer es etwas weniger ernsthaft, mit etwas mehr Charme mag, doch nicht weniger dramatisch, sollte einen Blick riskieren. 🙂
Donnerstag, 11. September 2008
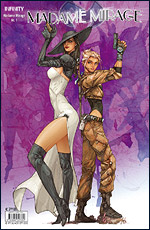 Plötzlich gibt es Helden. Keine normalen Menschen, die sich durch besondere Taten hervortun, sondern solche, die durch Biotechnik und Kybernetik tatsächlich in der Lage sind, übermenschliche Leistungen zu vollbringen. Doch was Helden recht ist, ist den Schurken auch billig. Letztere sind bald in der Überzahl. Eine neue Form der Kriminalität entsteht und anders als in den bekannten Märchen über Superhelden stellt sich den bösen am Ende niemand mehr in den Weg. Niemand? Eine elegant gekleidete Frau wirft ihren langen Schatten voraus, einen Schatten, der besonders auf jene fällt, die sich dem Verbrechen verschrieben haben.
Plötzlich gibt es Helden. Keine normalen Menschen, die sich durch besondere Taten hervortun, sondern solche, die durch Biotechnik und Kybernetik tatsächlich in der Lage sind, übermenschliche Leistungen zu vollbringen. Doch was Helden recht ist, ist den Schurken auch billig. Letztere sind bald in der Überzahl. Eine neue Form der Kriminalität entsteht und anders als in den bekannten Märchen über Superhelden stellt sich den bösen am Ende niemand mehr in den Weg. Niemand? Eine elegant gekleidete Frau wirft ihren langen Schatten voraus, einen Schatten, der besonders auf jene fällt, die sich dem Verbrechen verschrieben haben.
Die meisten Supergangster haben ihre Kostüme abgelegt, agieren im Verborgenen und treten in maßgeschneiderten Anzügen spazieren. Nur noch die wenigsten stellen ihre besonderen Fähigkeiten zur Schau, höchstens zur Einschüchterung oder bei der Einfädelung eines halbseidenen Geschäfts.
Madame Mirage ist anders. Furchtlos, mit einer peniblen Planung und tödlicher Konsequenz geht sie ans Werk und erklärt dem organisierten Verbrechen den Krieg.
Paul Dini ist ein Veteran auf dem Gebiet der Comics und hat schon eine Reihe von gestandenen Namen durcheinander gewirbelt, insbesondere im Animationsbereich. Harley Quinn, Zatanna oder Black Canary sind nur einige wenige Namen aus seinen Arbeiten. Mit Madame Mirage hat er nun eine Art weibliches Gegenstück zum Shadow entworfen, hierzulande eher durch die Verfilmung mit Alec Baldwin bekannt.
Das wirklich Geheimnisvolle fehlt Madame Mirage allerdings. Zwar hat sie eine Menge Tricks auf Lager, aber sie ist auch sehr frech, besitzt natürlich auch Charme, aber letztlich fällt es durch die Sexbomben-Aura, die sie umgibt, auch schwer, diese Figur ernst zu nehmen. Ihre Kontrahenten nehmen sie jedoch wegen ihrer Effizienz sehr ernst. Diese, ihre Feinde, lassen sich nicht so einfach über einen Kamm scheren. Neben dem normalen Gangster macht der Lese auch die Bekanntschaft mit einem wahren Muskelberg, dessen Selbstheilungskräfte denen sehr bekannter Comicfiguren in nichts nachstehen.
Kenneth Rocafort könnte eine künstlerische Kreuzung aus Sean Philips und Leinil Francis Yu. Rocafort arbeitet gerne mit interessanten Perspektiven, beleuchtet eine Szene oder eine Figur gerne von mehreren Seiten. Insgesamt entsteht ein sehr zerbrechlicher Eindruck der Zeichnungen. Seine Fähigkeiten konnte er auch schon eindrucksvoll bei Hunter Killer und Cyber Force unter Beweis stellen. Farblich treten das Imaginary Friends Studios, Rocafort selbst und Blond auf das Gaspedal. Hier werden einige Farbtechniken miteinander gemischt, immer auf das beste Ergebnis bedacht: Verläufe, feine Pinselstriche, oder auch mit der groben Kelle aufgetragen, Wolkenspielchen, farblich multipliziert, ineinanderkopiert, Photoshop sei Dank, alles ist möglich, viele Wege führen nach Rom.
Ein sehr nettes Superhelden-Rache-Szenario, das auf die Fortsetzung neugierig macht. Paul Dini legt hier den Grundstein für eine längere Geschichte – bei einem Veteran, der den Umgang mit Serien gewöhnt ist, könnten so noch einige Überraschungen ins Haus stehen. 🙂
Montag, 18. August 2008
 Fassungslos muss der Junge zusehen, wie seine Eltern vor seinen Augen erschossen werden. Batman hatte den Wunderjungen schon lange im Auge. Die artistische Begabung ist außerordentlich. Allerdings hatte Batman nicht damit gerechnet, dass sein Eingreifen so schnell erforderlich werden würde. Eigentlich sollte es ein netter Abend für Bruce Wayne werden. Er hatte Vicky Vale zu einem Rendevous eingeladen. Die Kolumnistin hatte sich extra für ihn in Schale geschmissen. Ihr Ziel, ein Zirkus, bot eine gute Show. Und dann das!
Fassungslos muss der Junge zusehen, wie seine Eltern vor seinen Augen erschossen werden. Batman hatte den Wunderjungen schon lange im Auge. Die artistische Begabung ist außerordentlich. Allerdings hatte Batman nicht damit gerechnet, dass sein Eingreifen so schnell erforderlich werden würde. Eigentlich sollte es ein netter Abend für Bruce Wayne werden. Er hatte Vicky Vale zu einem Rendevous eingeladen. Die Kolumnistin hatte sich extra für ihn in Schale geschmissen. Ihr Ziel, ein Zirkus, bot eine gute Show. Und dann das!
Schluss mit lustig! Batman kann den Killer wenig später identifizieren. Jacko-Boy Vanzetti, ein kleiner Gangster, der für Geld für jeden Job zu haben ist. Doch der Killer ist nicht der einzige, der ein Interesse an den Graysons, den Artisten, hatte. Obwohl sich ihr Sohn in der Obhut der Polizei befindet, ist er nicht in Sicherheit. Batman greift ein. Ein riesiger Fledermausschwarm geht ihm voraus.
Du bist jetzt ein Rekrut. Es ist Krieg.
Batman kann Gangster und anderem Geschmeiß auf vielerlei Arten Angst einjagen. Er kann sie verdreschen und seine dunkle Natur hervorragend auf den finsteren Straßen abreagieren. Aber mit einem Kind vermag er nicht umzugehen. Seiner Meinung nach muss ein Kind so leiden, wie er einst leiden musste. Bei seinem Faktotum Alfred stößt er mit dieser Erziehungsmethode auf taube Ohren. Und so herzlos, wie Alfred ihm unterstellt, ist er schließlich auch nicht. Immerhin organisiert er für die verunglückte Vicky den besten Arzt, der zu haben ist. Der wohnt nur leider in Paris.
Der Kasper aus Metropolis soll ihn holen. Ruf Kent an, beim Daily Planet. Der kümmert sich drum. Und sag ihm, er tut Batman damit einen großen Gefallen.
Frank Miller hat sich den dunklen Ritter erneut vorgenommen. Nach einem gealterten und desillusionierten Exemplar ist dieser Batman ein krankes Individuum, dessen Verbrecherjagd Ausdruck von Mission und Wahnsinn ist. Mit seinen Tricks und technischen Methoden – die vom Feinsten sind, wie man so schön sagt – hat er sich nicht nur Respekt bei den Verbrechern verschafft. Seine Heldenkollegen sehen seine Machenschaften mit äußerstem Argwohn. Er hat es sogar soweit gebracht, Superman erpressen zu können, denn er kennt die Geheimidentität des Stählernen – Superman weiß hingegen nicht, wer Batman in Wahrheit ist.
Batman ist ein wenig freaky, leicht reizbar, leicht eingeschnappt. Der spätere Robin findet den Namen seines Autos – Batmobil – tuntig. Batman ist not amused. Kein Wunder, schließlich handelt es sich bei dem Batmobil um ein Fahrzeug, das fahren, fliegen und tauchen kann. Batmans Grinsen ist diabolisch, sein Vorgehen halsbrecherisch. Alles in allem benimmt er sich wie ein Adrenalin-Junkie, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Allerdings ist er auch intelligent und nutzt seine vorhandenen Ressourcen präzise. Die Bathöhle ist riesig. Roboter bauen und entwerfen sich selbst, die Höhle ist ein riesiger Spielplatz für einen selbst ernannten Vigilanten.
Frank Miller hält sich aber nicht nur mit einem für normale Leseraugen merkwürdigen Batman auf, sondern er zeigt auch völlig andere Nebenfiguren. Aus Black Canary wurde eine junge Frau, die heimlich trainiert hat, um sich für all die Pöbeleien der Typen, die sie anmachen, während sie hinter dem Tresen steht, zu revanchieren. Irgendwann rastet sie aus, schlägt den halben Laden zusammen, die Typen gleich mit, stiehlt deren Geldbörsen und eine Harley Davidson gleich dazu. Ein neues Nachtwesen ist geboren.
In Metropolis beschäftigen sich Superman, Plastic Man, Green Lantern und Wonder Woman mit dem düsteren Phänomen in Gotham City. Leiden können sie ihn alle nicht. Bislang haben sie ihn als Außenseiter verachtet (seine Methoden sowieso), doch nun erhält ihre Meinung über ihn eine ganz andere Dimension. Batman hat ein Kind entführt – dass Dick Grayson zu einem Lehrling des dunklen Ritters werden soll, ahnen sie nicht. Der Fledermausmensch diskreditiert alle Superhelden und gibt den Verantwortlichen endlich die Handhabe, um gegen alle Superwesen vorzugehen.
Millers Helden – und das haben sie mit seinen Figuren aus anderen Batman-Geschichten gemein – wirken immer etwas unfähig. Nur Batman weiß, wo es lang geht. Immerhin ist er auch derjenige, der weiß, dass Kal-El fliegen kann. Im Gegensatz zu Superman, der von dieser Fähigkeit noch überhaupt nichts weiß und nur schnell läuft. Eine JLA gibt es nicht. Die Helden treffen sich in einer verlassenen Lagerhalle. Und trotzdem eifert so mancher diesem Batman nach. Gerade für junge Frauen scheint dieser Mann ein gewisser Anziehungspunkt zu sein, so auch für ein 15 Jahre altes Mädchen namens Barbara Gordon.
Der besondere Punkt ist die grafische Aufmachung. Jim Lee zeichnet mit der Unterstützung von Scott Williams (Tusche) und Alex Sinclair (Farben) ein bildnerisches Feuerwerk, wie es der Fan bereits aus Batman-Event Hush her kennt. Hätte Miller auch an die Bilder Hand angelegt, wie er es auf alternativen Covern getan hat, hätte die Geschichte recht schnell ins Lächerliche abgleiten können. So aber sind Bilder dank Jim Lee entstanden, die vor lauter Kraft beinahe platzen. Richtig toll wird es, wenn sich Lee ganz- oder doppelseitig austoben kann. Generell gilt bei Lee: Titelbildqualität = Comicqualität. Da gibt es keinerlei Unterschied.
Wer schon andere Batmans von Miller nicht mochte: Finger weg. Wer einen Batman sehen und lesen möchte, der einen vollkommen eigenen Weg geht – der sich um nichts und niemanden schert, sich selber nicht schont und es geil findet Batman zu sein, wie er sich einmal selbst ausdrückt – der hat hier einen alternativen Batman vor sich, bei dem es noch heiß her gehen kann, denn der Joker hat seinen Einstand noch nicht gegeben. Ein Freaky- und Brutalo-Batman in faszinierenden und technisch einwandfreien Bildern von Jim Lee.
All Star Batman – Gesamtausgabe 1: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 14. August 2008
 Viele Freunde sind tot. Von den einstigen Specials, jenen Menschen mit außerordentlichen Kräften, sind nur noch wenige übrig. John und Randy gehören zu den mächtigsten von ihnen. Beide haben einen Plan gefasst. So unterschiedlich die beiden Männer sind, so verschieden sind auch ihre Ideen für eine Zukunft. Randy jagte Verbrecher. Drogendealer zittern vor ihm. Er hat viele städtische Bezirke ruhiger, lebenswerter gemacht. Aber Randy will mehr. Er will in eine Position gelangen, die ihm die Möglichkeit gibt, wirklich und langfristig etwas zu verändern. Randy will Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.
Viele Freunde sind tot. Von den einstigen Specials, jenen Menschen mit außerordentlichen Kräften, sind nur noch wenige übrig. John und Randy gehören zu den mächtigsten von ihnen. Beide haben einen Plan gefasst. So unterschiedlich die beiden Männer sind, so verschieden sind auch ihre Ideen für eine Zukunft. Randy jagte Verbrecher. Drogendealer zittern vor ihm. Er hat viele städtische Bezirke ruhiger, lebenswerter gemacht. Aber Randy will mehr. Er will in eine Position gelangen, die ihm die Möglichkeit gibt, wirklich und langfristig etwas zu verändern. Randy will Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.
Die Begeisterung aller Beteiligten über diesen Plan – außer bei Randy, der es für einen genialen Plan hält – bewegt sich innerhalb sehr enger Grenzen. Randy hat es trotz seiner ruhmreichen Vergangenheit nicht leicht. Männer, die ohne Partei im Rücken für das Amt des Präsidenten kandidieren, haben es generell in den USA nicht leicht. Aber Randy gibt nicht auf. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann beim nächsten Mal. Oder dem nächsten Versuch. Und manchmal braucht es auch ein wenig Glück.
Eine Saga, die sich über Jahrzehnte erstreckt, findet ihr Ende. Ist es traurig, ist es hoffnungsvoll, was J. Michael Straczynski sich ausgedacht hat? In jedem Fall hat der bekannte Autor (Babylon 5, Spider-Man) versucht, auf einer realistischen Ebene zu bleiben. Was wäre, wenn es Superhelden tatsächlich gäbe? Diese Frage haben sich schon andere Autoren wie Alan Moore oder Garth Ennis gestellt. Die Ergebnisse waren eher zynischer Natur, eine Art Überspitzung bestehender Superhelden-Epen und –Serien.
Da die Helden der Rising Stars nicht alle mit einer stabilen Psyche ausgestattet waren, kam es auch zu Kämpfen untereinander. Die Specials, wie sie von der Bevölkerung genannt werden, sind stark dezimiert worden, nicht zuletzt auch durch ein Attentat militärischer Kräfte, die nun endlich ein Mittel gegen diese Überwesen gefunden haben.
Die Überschaubarkeit der übrig gebliebenen Charaktere ermöglicht eine höhere Konzentration und bestärkt die Faszination, die schon von Randy und John ausging. Um den unheimlichen Anteil an der Geschichte zu erhöhen, kommt ein Special ins Spiel, der bisher eher abseits stand – sogar aus überaus verständlichen Gründen.
Lionel kann mit den Toten sprechen. Oder besser, sie sprechen zu ihm, wollen all ihre Geheimnisse loswerden, sobald sie nur einen Zuhörer finden. Deshalb lebt Lionel sehr zurückgezogen an einem Ort, an dem niemand gestorben ist und reden kann. Der Ghost Whisperer erfährt Geheimnisse, die sonst nur wenige kennen, nachdem er eine Nacht auf dem Friedhof in Arlington zugebracht hat. Am Grab von John Fitzgerald Kennedy beginnt Lionel mit dem Zuhören.
Straczynski erörtet kurz, welche Geheimnisse gelüftet werden, lässt den Leser aber im Unklaren über die Antworten. Allerdings findet sich eine interessante Szene, in der Randy dem Kongress und den anwesenden Militärs erläutert, über welches Wissen er nun verfügt. Die Macht, die er dadurch besitzt, ist unglaublich.
Zunächst sieht alles nach einem spannenden, aber gut ausgehenden Finale aus. Aber ein Präsident, der seine Gefolgschaft in gewissem Sinne erpressen muss, damit sie ihm uneingeschränkt gehorcht, kann nicht wirklich glauben, dass er lange an der Macht bleibt. So beobachtet der Leser die aufkeimenden Intrigen hinter den Kulissen, ganz so, wie es auch schon Oliver Stone mit seinem Film JFK aufgezeigt hat.
Brent Anderson zeichnet auf einem gewohnt guten Niveau in dieser Ausgabe, doch er hat auch Höhen und Tiefen, was die Tuscheumsetzung seiner Bilder angeht. Die Handlung macht ihm auch seine Arbeit relativ leicht. Action gab es in den vorhergehenden Bänden reichlich, hier spielt es sich viel stiller, auch häufig in Räumen oder an Tischen ab. Anderson zeichnet einen langen Abschied von seinen Figuren, die sicherlich über die gleiche Tiefe verfügen wie alteingesessene Charaktere in anderen Comic-Universen.
Eine Frage, deren Antwort über allem anderen steht, muss noch geklärt werden. Woher kam die Kraft, die einige Menschen mit besonderen Kräften ausstattete? Und was soll aus ihr werden, wenn die Specials einmal nicht mehr sind?
Die Lösung, die sich Straczynski hierfür ausgedacht hat, ist schlüssig, schön und traurig.
Ein toller Schluss für eine sehr gute Superhelden-Saga der anderen Art. J. Michael Straczynski hat hier etwas ganz eigenes geschrieben, innovativ, schlüssig, erwachsen. Brent Anderson dokumentiert diese Geschichte, anders lässt sich sein Zeichenstil hier nicht besser beschreiben, versiert und mit viel Respekt für die Figuren. Sehr gut. 🙂
J. Michael Straczynski’s Rising Stars – 3. Akt – Teil 2: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 07. August 2008
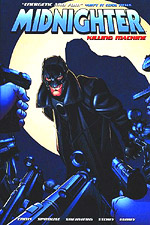 Der Midnighter hat Langeweile. Er kann mit den Freizeitaktivitäten seiner Kameraden nichts anfangen, noch kann er sich für ein Miteinander begeistern, an dem ihm nichts liegt. Er kann nur eines gut: Töten. Hoch oben im Orbit über dem Planeten Erde, wo die Raumstation der Authority ihre Bahnen zieht, sucht er sich auf dem Globus ein neues Ziel durch Drehen der Erdkugelnachbildung: Afghanistan. Jeder, der dort den Anschein eines gemeingefährlichen Irren hat, kann sich warm anziehen. Die Panzer, die dem Midnighter entgegenjagen, sind keine Gegner. Ein Mann, der den nächsten Zug seines Gegners vorhersehen, braucht nichts zu fürchten. Oder doch?
Der Midnighter hat Langeweile. Er kann mit den Freizeitaktivitäten seiner Kameraden nichts anfangen, noch kann er sich für ein Miteinander begeistern, an dem ihm nichts liegt. Er kann nur eines gut: Töten. Hoch oben im Orbit über dem Planeten Erde, wo die Raumstation der Authority ihre Bahnen zieht, sucht er sich auf dem Globus ein neues Ziel durch Drehen der Erdkugelnachbildung: Afghanistan. Jeder, der dort den Anschein eines gemeingefährlichen Irren hat, kann sich warm anziehen. Die Panzer, die dem Midnighter entgegenjagen, sind keine Gegner. Ein Mann, der den nächsten Zug seines Gegners vorhersehen, braucht nichts zu fürchten. Oder doch?
Die Reise zurück zur Raumstation ist kurz. Eigentlich ist fast alles wie immer. Aber eben nur fast. Ein Unbekannter fängt den Midnighter ab und dieser kann nichts vorhersehen. Die Schläge kommen unerwartet, gemein und treffsicher. Wenig später erwacht der Midnighter in Gefangenschaft auf dem Boden eines kargen Raumes. Sein Gastgeber, ein älterer Mann namens Paulus, begrüßt ihn geschäftsmäßig, stellt ihm eine Art Wachmannschaft vor und erörtert ihm noch ein wenig später seine Aufgabe. Falls er am Leben hänge – man implantierte ihm während seiner Bewusstlosigkeit eine fernzündbare Bombe – müsse er jemanden ermorden.
Das Ziel sei der größte Massenmörder des 20. Jahrhunderts: Adolf Hitler.
Midnighter – Killing Machine beschreibt mit seinem Untertitel in zwei Worten, was unser Held eigentlich ist: Eine Mordmaschine. Für alle Beteiligten kann es nur von Vorteil sein, dass eine seltsame Moral den Midnighter auf die richtige Seite des Gesetzes gezwungen hat. Allerdings hält er von den bestehenden Gesetzen nicht allzu viel. Er hält es lieber alttestamentarisch: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Geprägt von einer Spur Selbstverachtung, etwas Sadismus – den er zumeist relativ kurz auslebt, bei weitem aber nicht schmerzlos – einem detektivischen Spürsinn ist er ein ziemlich böser Batman eines anderen Comic-Universums. Seine Homosexualität ist auch nicht dazu angetan, ihm das Leben zu erleichtern, im Gegenteil.
Dieser Mann, diese Mordmaschine, wird nun in der vorliegenden Geschichte von Autor Garth Ennis, der nicht zimperlich in seinen Erzählungen ist, gezwungen, in der Zeit zurückzureisen, um das zu vollbringen, was diverse Attentaten während des Zweiten Weltkriegs nicht gelang.
Inmitten der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs taucht der Midnighter zum ersten Mal auf, wo er mitten im Schusswechsel der Deutschen und Franzosen auf den Gefreiten Hitler trifft. Doch bevor er – mit einem gewissen Genuss – zur Tat schreiten kann, wird er aufgehalten.
Wie der Leser es vielleicht auch aus dem allseits beliebten Star Trek-Universum her kennt, gibt es auch hier eine Polizeieinheit, die über die Kontinuität der Zeitlinie wacht. Was geschehen ist, ist geschehen und darf nicht geändert werden. Aus dieser Situation entwickelt Ennis eine Hetzjagd, die kurz darauf in Berlin im April des Jahres 1945 endet.
Was zuerst eine handfeste – wenn auch abgedrehte – Superheldengeschichte war, mit einer Prise Science Fiction versehen, driftet manchmal in die Farce ab und wer ein wenig von Ennis gelesen hat, weiß, dass dies auch durchaus gewollt ist. Garth Ennis lässt sich in seinen Erzählungen nicht einengen. Fast fühlt man sich in dieser Szenerie an den Beginn der gelungenen Komödie Schtonk erinnert, die mit dem Untergang 1945 beginnt. Hier wie dort brennt schlussendlich der Führer, wenngleich man hier keinerlei Schwierigkeiten damit hat, den Leichnam in Brand zu setzen und sogar ein Freudenfeuer daraus zelebriert.
Federführend bei dieser Geschichte ist Chris Sprouse, der im Laufe des hier zusammengefassten Vierteilers mit den unterstützenden Kräften von Joe Philips und Peter Snejbjerg die Bilder umsetzt. Gerade im dritten Kapitel, bei der Zusammenarbeit mit Philips, zeigt sich auch optisch ein Hang zur Farce, zur bitterbösen Komödie, wenn der Midnighter eine Gruppe von Partisanenkindern vor russischen Soldaten rettet. Wenn diese Kinder ihren Retter wegen seiner schwarzen lederkluftigen Kleidung für jemanden von der Gestapo halten, ist das nur die Spitze des Eisbergs dessen, was sich Ennis für dieses Kapitel ausgedacht hat.
Das genannte Kapitel fällt auch insgesamt etwas aus dem Rahmen, ist verspielter, während in den übrigen drei Kapiteln auf möglichst viel Realismus gesetzt wird, den Sprouse mit dem gleichen Aufwand zeichnet, den er auch den einzelnen Covern zuteil werden lässt.
Die von Glenn Fabry (bekannt durch seine Preacher-Cover) gezeichnete Geschichte Blumen für die Sonne schließt den Band thematisch vollkommen anders gelagert ab. Es dürfte sich dabei um die blutigste Liebesgeschichte seit Kill Bill handeln – so ist Garth Ennis eben. Man mag ihn oder lässt es besser sein.
Man nehme die grausamsten Geschichten mit Wolverine, mische ein wenig Batman unter, nehme das grundlegende Flair des Wildstorm-Universums, lasse es von Garth Ennis kräftig durchrühren und schmecke mit schönen (aber keinesfalls für jeden geeigneten) Bildern ab. Das ist nichts für jeden Gaumen, aber auf jeden Fall einwandfrei gekocht. 🙂
Dienstag, 22. Juli 2008
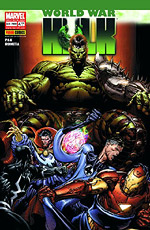 Madison Square Garden – Es hat keine Schlacht in New York gegeben, wenn nicht auch die weltberühmte Sportarena in Mitleidenschaft gezogen wurde oder wenigstens eine Rolle gespielt hat. Hier reißen Hulk und seine Freunde kurzerhand das Dach entzwei. Zu einem Gladiator haben die Verschwörer ihn werden lassen. Es wird Zeit, ihnen ihre Heimtücke mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Madison Square Garden – Es hat keine Schlacht in New York gegeben, wenn nicht auch die weltberühmte Sportarena in Mitleidenschaft gezogen wurde oder wenigstens eine Rolle gespielt hat. Hier reißen Hulk und seine Freunde kurzerhand das Dach entzwei. Zu einem Gladiator haben die Verschwörer ihn werden lassen. Es wird Zeit, ihnen ihre Heimtücke mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Doch zuvor setzt Dr. Strange einen waghalsigen Plan in die Tat um. Er beschwört einen Dämon, dessen Kräfte ausreichend sein könnten, um den Hulk zu besiegen. Und wer hätte das gedacht? Zuerst sieht es wirklich so aus, als könne Strange nun siegen. Zunächst …
Später sehen sich die vier Verschwörer, Dr. Strange, Black Bolt, Tony Stark und Reed Richards, ihrem Schicksal gegenüber. Sie sollen kämpfen. Zuerst gegen Monster, die auch der Hulk besiegen musste. Ihrer Kräfte beraubt und durch eine den Willen brechende Technik versklavt, bleibt ihnen keine Wahl. Wenig später tobt im Madison Square Garden ein Kampf auf Leben und Tod.
Jetzt ist endgültig vorbei mit der Ruhe. In der Arena wird gekämpft. Greg Pak lässt keine Verzögerung mehr zu. Ein paar Einwände von Rick Jones werden einsilbig beiseite gewischt. Magie ist zu Beginn die Waffe, die es doch noch schaffen könnte. Pak reaktiviert zu diesem Zweck eine dämonische Figur namens Zom. Der Werdegang dieser Figur, kreiert 1967, also ordentlich alt, wird im Anhang, im Kriegstagebuch ausführlich beschrieben. Diese Gestalt besitzt außerordentliche Kräfte und bisher waren zumeist Gegner nötig, die eindeutig stärker als Dr. Strange waren, um diesen Dämonen wieder in seine Schranken zu weisen. – Hier braucht man nur einen Hulk.
Dies sollte die Energie unterstreichen, mit der die Handlung ihren Fortgang nimmt. Der Kampf präsentiert sich mit einer Urgewalt von King Kong gegen King Kong und nicht nur die Passanten verfolgen dieses Gemetzel mit großen Augen.
Genau diese normalen Menschen werden zu Anklägern. Es ist nicht neu, dass die Helden auch für große Fehler verantwortlich sind – ein Grund, warum sich Captain America ergab und so den Civil War beendete. Oftmals werden jene vernachlässigt, die eigentlich beschützt werden sollen. Die sehr subjektive Gerichtsbarkeit und Kontrolle, die mit der Initiative geschaffen wurde, spielt hier keine Rolle mehr. Die strahlenden Helden des Marvel-Universums erfahren hier, was es heißt geächtet und verurteilt zu werden.
Nach einem furiosen Auftakt dieses Teils, in dem der Hulk den letzten Illuminati eingefangen hat, treten die guten Helden gegeneinander an. Mit Hieb- und Stichwaffen, die Hellebarden nicht unähnlich sind, magischem Feuer, Äxten und stacheligen Keulen bewaffnet gehen sie aufeinander los. Endlich erreicht der Hulk sein Ziel: Na, so was, sie sind ja auch Monster.
Greg Pak lässt seine Protagonisten Keile verteilen – aber mit Karacho. Die enorme Geschwindigkeit der Handlung wird von John Romit Jr. mit Momentaufnahmen umgesetzt, der Technik von Videoclips nicht unähnlich. Doch anders als in einem Kinofilm, in dem eine solche Technik schnell in eine lange Reihe hektischer Bildwechsel umschlägt, kann der Leser hier jedes einzelne Bild in Ruhe studieren – aber das wird er erst beim zweiten Lesen machen, denn vorher wird die Geschwindigkeitsvorgabe greifen. Man muss einfach wissen, wie es weitergeht.
Jetzt muss man nur noch wissen, wie es endet. Alleine die Vorschau des Covers verspricht ein unglaubliches Finale. 🙂
 Die Frau soll ihm nicht entkommen. Das wäre ja auch gelacht. Auf dem Pier haben die Gangster und ihre Anführerin keine Fluchtmöglichkeiten. Aber Madame X will gar nicht entkommen. Ihr Plan ist nicht sehr ausgefeilt. Sie will ledglich ganz Gotham City vergiften. Wenn dabei auch noch Batman eine Dosis abbekommt, umso besser. Eben konnten die Leser noch die neue Spirit-Variante von Darwyn Cooke ins Auge fassen und schon kehrt er unter der Regie von Paul Grist zu seinen Wurzeln zurück. Wie schon in anderen Situationen muss Batman den Einfluss von Drogen auf sein Gehirn bekämpfen.
Die Frau soll ihm nicht entkommen. Das wäre ja auch gelacht. Auf dem Pier haben die Gangster und ihre Anführerin keine Fluchtmöglichkeiten. Aber Madame X will gar nicht entkommen. Ihr Plan ist nicht sehr ausgefeilt. Sie will ledglich ganz Gotham City vergiften. Wenn dabei auch noch Batman eine Dosis abbekommt, umso besser. Eben konnten die Leser noch die neue Spirit-Variante von Darwyn Cooke ins Auge fassen und schon kehrt er unter der Regie von Paul Grist zu seinen Wurzeln zurück. Wie schon in anderen Situationen muss Batman den Einfluss von Drogen auf sein Gehirn bekämpfen.









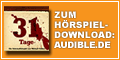

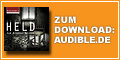
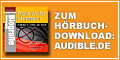



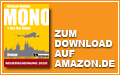
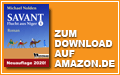
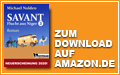
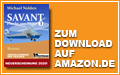
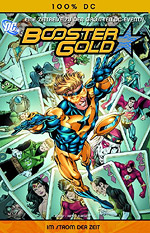 Booster Gold gehört nicht zu den beliebtesten Helden im Universum. Ihm haftet ein schlechtes Image an, weil er stets etwas egoistisch an diverse Angelegenheiten herangegangen ist. Der Mietheld aus der Zukunft konnte mit seinem strahlenden Lächeln nie so recht landen – bei den anderen, echten Helden nicht und bei den normalen Menschen auch nicht. Das soll nun anders werden. Booster ist kein schlechter Kerl. Immerhin stürzt er sich ohne ein Zögern auf Gauner und Halunken. Allerdings auch ohne großartig über sein Handeln nachzudenken. Aber auch ein neuerlicher Sieg über die Royal Flush Gang kann die JLA nicht davon überzeugen, ihn in ihre Reihen aufzunehmen.
Booster Gold gehört nicht zu den beliebtesten Helden im Universum. Ihm haftet ein schlechtes Image an, weil er stets etwas egoistisch an diverse Angelegenheiten herangegangen ist. Der Mietheld aus der Zukunft konnte mit seinem strahlenden Lächeln nie so recht landen – bei den anderen, echten Helden nicht und bei den normalen Menschen auch nicht. Das soll nun anders werden. Booster ist kein schlechter Kerl. Immerhin stürzt er sich ohne ein Zögern auf Gauner und Halunken. Allerdings auch ohne großartig über sein Handeln nachzudenken. Aber auch ein neuerlicher Sieg über die Royal Flush Gang kann die JLA nicht davon überzeugen, ihn in ihre Reihen aufzunehmen. Batman wollte sich genau in diesem Augenblick einen Verbrecher schnappen – als es ihn schnappte. Auch Superman hatte eigentlich etwas ganz anderes im Sinn, aber plötzlich steht er vor einer Versammlung von Superhelden und seltsamerweise sind viele darunter gleich mehrfach vorhanden – und auch irgendwie nicht. Alle, wie sie da sind, sind Entführungsopfer. Bei manchen der anwesenden Helden ist dies kaum begreiflich, stellen sie doch die mächtigsten Lebewesen dar, die ihre jeweilige Erde zu bieten hat. So ist Superman nicht das einzige Superwesen. Auch Batman ist nicht der einzige dunkle Ritter – und auch er hat sich seine alternativen Identitäten aus Paralleluniversen sicherlich anders vorgestellt.
Batman wollte sich genau in diesem Augenblick einen Verbrecher schnappen – als es ihn schnappte. Auch Superman hatte eigentlich etwas ganz anderes im Sinn, aber plötzlich steht er vor einer Versammlung von Superhelden und seltsamerweise sind viele darunter gleich mehrfach vorhanden – und auch irgendwie nicht. Alle, wie sie da sind, sind Entführungsopfer. Bei manchen der anwesenden Helden ist dies kaum begreiflich, stellen sie doch die mächtigsten Lebewesen dar, die ihre jeweilige Erde zu bieten hat. So ist Superman nicht das einzige Superwesen. Auch Batman ist nicht der einzige dunkle Ritter – und auch er hat sich seine alternativen Identitäten aus Paralleluniversen sicherlich anders vorgestellt. Nathan hatte einen furchtbaren Alptraum. Wieder musste miterleben, wie seine Familie getötet wurde. Eines Tages jedoch erhält er die Chance zur Rache. Als er im Krankenhausbett erwacht, ist sein amputiertes Bein wieder da. Aber dennoch: Etwas ist anders. Früher hat ein ganz normales Auftreten auf den Boden keine Fußabdrücke im Beton hinterlassen. Aus einer anfänglichen Panik erwächst sehr bald Gewissheit dank der Hilfe der Justice Society of America. Nathan hat eine flüssige Metalllegierung in seinem Körper aufgenommen, die ihn schützt und neue Kräfte verleiht. Leider hat er diese noch ganz und gar nicht unter Kontrolle. Die JSA schafft mit einem neuen – sehr ungewöhnlichen – Kostüm Abhilfe. Und ob er es will oder nicht: Citizen Steel ist geboren.
Nathan hatte einen furchtbaren Alptraum. Wieder musste miterleben, wie seine Familie getötet wurde. Eines Tages jedoch erhält er die Chance zur Rache. Als er im Krankenhausbett erwacht, ist sein amputiertes Bein wieder da. Aber dennoch: Etwas ist anders. Früher hat ein ganz normales Auftreten auf den Boden keine Fußabdrücke im Beton hinterlassen. Aus einer anfänglichen Panik erwächst sehr bald Gewissheit dank der Hilfe der Justice Society of America. Nathan hat eine flüssige Metalllegierung in seinem Körper aufgenommen, die ihn schützt und neue Kräfte verleiht. Leider hat er diese noch ganz und gar nicht unter Kontrolle. Die JSA schafft mit einem neuen – sehr ungewöhnlichen – Kostüm Abhilfe. Und ob er es will oder nicht: Citizen Steel ist geboren. Fast Food ist nicht gut für die Gesundheit. So ein Hot Dog mit allem, Sauerkraut und seltsamen Saucen, besonders wenn sie mit Botox in hoher Konzentration versetzt sind, können dem menschlichen Organismus schon mal den Garaus machen. Tom Ragg ist tot. Was Tom nicht wusste: Er war nur ein Köder. Auf der Gegenseite glaubt man, dass Madame Mirage diesen Köder mit Pauken und Trompeten geschluckt hat, aber jemand, der sich mit Gangstern der übelsten Sorte anlegt, ist nicht so dumm zu glauben, dass sich diese Gangster nicht auch Gegenmaßnahmen überlegen würden.
Fast Food ist nicht gut für die Gesundheit. So ein Hot Dog mit allem, Sauerkraut und seltsamen Saucen, besonders wenn sie mit Botox in hoher Konzentration versetzt sind, können dem menschlichen Organismus schon mal den Garaus machen. Tom Ragg ist tot. Was Tom nicht wusste: Er war nur ein Köder. Auf der Gegenseite glaubt man, dass Madame Mirage diesen Köder mit Pauken und Trompeten geschluckt hat, aber jemand, der sich mit Gangstern der übelsten Sorte anlegt, ist nicht so dumm zu glauben, dass sich diese Gangster nicht auch Gegenmaßnahmen überlegen würden.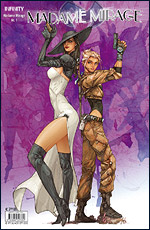 Plötzlich gibt es Helden. Keine normalen Menschen, die sich durch besondere Taten hervortun, sondern solche, die durch Biotechnik und Kybernetik tatsächlich in der Lage sind, übermenschliche Leistungen zu vollbringen. Doch was Helden recht ist, ist den Schurken auch billig. Letztere sind bald in der Überzahl. Eine neue Form der Kriminalität entsteht und anders als in den bekannten Märchen über Superhelden stellt sich den bösen am Ende niemand mehr in den Weg. Niemand? Eine elegant gekleidete Frau wirft ihren langen Schatten voraus, einen Schatten, der besonders auf jene fällt, die sich dem Verbrechen verschrieben haben.
Plötzlich gibt es Helden. Keine normalen Menschen, die sich durch besondere Taten hervortun, sondern solche, die durch Biotechnik und Kybernetik tatsächlich in der Lage sind, übermenschliche Leistungen zu vollbringen. Doch was Helden recht ist, ist den Schurken auch billig. Letztere sind bald in der Überzahl. Eine neue Form der Kriminalität entsteht und anders als in den bekannten Märchen über Superhelden stellt sich den bösen am Ende niemand mehr in den Weg. Niemand? Eine elegant gekleidete Frau wirft ihren langen Schatten voraus, einen Schatten, der besonders auf jene fällt, die sich dem Verbrechen verschrieben haben.

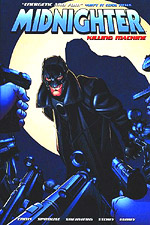 Der Midnighter hat Langeweile. Er kann mit den Freizeitaktivitäten seiner Kameraden nichts anfangen, noch kann er sich für ein Miteinander begeistern, an dem ihm nichts liegt. Er kann nur eines gut: Töten. Hoch oben im Orbit über dem Planeten Erde, wo die Raumstation der Authority ihre Bahnen zieht, sucht er sich auf dem Globus ein neues Ziel durch Drehen der Erdkugelnachbildung: Afghanistan. Jeder, der dort den Anschein eines gemeingefährlichen Irren hat, kann sich warm anziehen. Die Panzer, die dem Midnighter entgegenjagen, sind keine Gegner. Ein Mann, der den nächsten Zug seines Gegners vorhersehen, braucht nichts zu fürchten. Oder doch?
Der Midnighter hat Langeweile. Er kann mit den Freizeitaktivitäten seiner Kameraden nichts anfangen, noch kann er sich für ein Miteinander begeistern, an dem ihm nichts liegt. Er kann nur eines gut: Töten. Hoch oben im Orbit über dem Planeten Erde, wo die Raumstation der Authority ihre Bahnen zieht, sucht er sich auf dem Globus ein neues Ziel durch Drehen der Erdkugelnachbildung: Afghanistan. Jeder, der dort den Anschein eines gemeingefährlichen Irren hat, kann sich warm anziehen. Die Panzer, die dem Midnighter entgegenjagen, sind keine Gegner. Ein Mann, der den nächsten Zug seines Gegners vorhersehen, braucht nichts zu fürchten. Oder doch?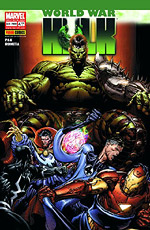 Madison Square Garden – Es hat keine Schlacht in New York gegeben, wenn nicht auch die weltberühmte Sportarena in Mitleidenschaft gezogen wurde oder wenigstens eine Rolle gespielt hat. Hier reißen Hulk und seine Freunde kurzerhand das Dach entzwei. Zu einem Gladiator haben die Verschwörer ihn werden lassen. Es wird Zeit, ihnen ihre Heimtücke mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Madison Square Garden – Es hat keine Schlacht in New York gegeben, wenn nicht auch die weltberühmte Sportarena in Mitleidenschaft gezogen wurde oder wenigstens eine Rolle gespielt hat. Hier reißen Hulk und seine Freunde kurzerhand das Dach entzwei. Zu einem Gladiator haben die Verschwörer ihn werden lassen. Es wird Zeit, ihnen ihre Heimtücke mit gleicher Münze heimzuzahlen.