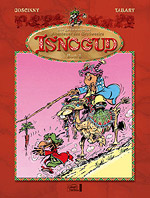Sonntag, 28. Dezember 2008
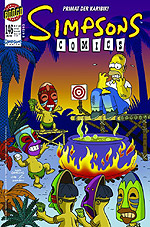 Eine Sportübertragung im Fernsehen – genauer ein Endspiel der Computerspieler – und eine Platte mit fettigem Essen, eine Flasche Bier, was will der Mensch, Verzeihung, der Homer mehr? Vielleicht ein neues verbessertes Bier? Als Homer die Reklame zum neuen verbesserten Duff im Fernsehen sieht, ist es jedenfalls gleich um ihn geschehen. Was könnte schöner sein als eine verbesserte Variante seines heiß und innig geliebten Getränks?
Eine Sportübertragung im Fernsehen – genauer ein Endspiel der Computerspieler – und eine Platte mit fettigem Essen, eine Flasche Bier, was will der Mensch, Verzeihung, der Homer mehr? Vielleicht ein neues verbessertes Bier? Als Homer die Reklame zum neuen verbesserten Duff im Fernsehen sieht, ist es jedenfalls gleich um ihn geschehen. Was könnte schöner sein als eine verbesserte Variante seines heiß und innig geliebten Getränks?
Sogleich macht er sich auf den Weg, den neuen Nektar auszuprobieren, der angeblich – so der Werbespruch – auf kaltem Feuer gebraut worden sein soll. Doch wie Lisa so treffend feststellt: Das ergibt keinen Sinn. Bald muss auch Homer einsehen, dass eine Verbesserung eines Produktes nicht unbedingt eine wirkliche Verbesserung sein muss. Das neue verbesserte Duff schmeckt grauenhaft.
Was tun? Heißt es nicht, dass der Verbraucher eine gewisse Macht besitzt? Bei der nächsten Sitzung der Duffco-Aktionäre macht sich Homer daran, diese These auf die Probe zu stellen. Und …
Bier!!! Das Getränk des Mannes, nicht Whisky, schon gar nicht Wein, nein, Bier! Dunkles, helles, irgendwelche farblichen Zwischentöne – nur nicht mit Limonade gemischt oder gar flavoured mit irgendeinem Knös – Hauptsache, Bier!!! Diese Vorstellung ist nicht amerikanisch, sie ist mannisch (vielleicht auch manchmal manisch, wer weiß?) Und doch gibt es immer wieder einmal irgendwelche besonderen Ultraschlauen, die meinen, sie hätten den besseren Geschmackssinn und müssten etwas besonders gutes noch besser machen.
Das kann ja nur schief gehen. Homers zarter Geschmackssinn verträgt diese Neuerung jedenfalls nicht: Das kann kein Duff sein! Das schmeckt ja wie Spucke!
So wird dank Erzähler Chuck Dixon aus einer Geschmacksverbesserung eine Odysse um die Welt. Vier Männer, beseelt vom Gedanken auf eine bessere Bierzukunft, machen sich auf, um den wahren Vater von Duff zu finden, der von den neuen Firmenchefs gefeuert wurde. Aus Homer wird Primat der Karibik und gleichzeitig entsteht so ein albernes Feuerwerk, wie es lange nicht mehr bei den Simpsons zu lesen war – ja, es gibt noch Steigerungen!
John Costanza scheint dieses Abenteuer sehr gemocht zu haben. Darf er doch Homer auf Indiana Jones’ Spuren schicken und kleine Männer mit Speeren auftreten lassen, deren Auftritt an die Ewoks erinnert. Da man gerade auf einer Insel ist, kann in einer weiteren Anspielung auch gleich Lost herangezogen werden. Zeichnerisch gibt es (wieder einmal) nichts zu bemängeln. Die Simpsons schauen aus wie immer. Als Leser fühlt man sich wie zuhause.
Mehr Action, mehr Anspielungen, weniger Bier: Ein neuer kleiner Höhepunkt der Reihe. Wenn Homer eine Reise tut – auch noch für einen guten Zweck: Bier – dann möge das Chaos zu uns kommen. Perfekter Spaß aus dem Hause Groening. 🙂
Dienstag, 23. Dezember 2008
 Ja, wer kommt denn da zu Besuch? Wer hätte gedacht, dass Cubitus und Boje einmal ihren Vater kennenlernen würden? Dupa wird freundlich empfangen und kann sich über die außerordentliche Gastfreundschaft der beiden urigen Typen freuen. Denn diese ist nicht nur formvollendet, sondern auch noch mit einem exquisiten Geschmack gesegnet. Dupa lässt es sich gut ergehen, wankt später nach Hause (ein edles Tröpfchen zuviel) und schläft den Schlaf des Zeichners, der den nächsten Arbeitstag kaum erwarten kann.
Ja, wer kommt denn da zu Besuch? Wer hätte gedacht, dass Cubitus und Boje einmal ihren Vater kennenlernen würden? Dupa wird freundlich empfangen und kann sich über die außerordentliche Gastfreundschaft der beiden urigen Typen freuen. Denn diese ist nicht nur formvollendet, sondern auch noch mit einem exquisiten Geschmack gesegnet. Dupa lässt es sich gut ergehen, wankt später nach Hause (ein edles Tröpfchen zuviel) und schläft den Schlaf des Zeichners, der den nächsten Arbeitstag kaum erwarten kann.
So wie Dupa in das Reich seiner Phantasie eintauchte, so verspielt malt sich auch Cubitus seine eigenen Gedanken aus. Wer wollte nicht schon einmal ein Lexikon zum Thema Sport im Stile eines Cubitus sehen. Sportarten wie Boxen, Fechten oder auch Turnen erhalten auf die Art eine völlig neue Interpretation. Überhaupt drängt Cubitus auf Neuinterpretationen. Seine kleine historische Episode entführt in den Wilden Westen, der dank einer Calamity Jane besonders wild war. Er setzt sich mit der Tücke des Objekts in Form eines Marmeladenglases auseinander. Obwohl hier bereits unter Lebensgefahr agiert wird, folgt die wirkliche Gefahr erst noch: in Form eines Eintreibers für Hundesteuern.
Wahre Flunkergeschichten oder: Wie Cubitus die Welt sieht. Nun, dieser weiße kugelrunde Kuschelhund hat seine ganz persönlichen Ansichten. Da macht ihm auch niemand etwas vor und es kann ihm auch niemand etwas ausreden. Cubitus ist Cubitus und hat Flausen im Kopf. Aber seien wir ehrlich: Gott sei Dank ist das so!
Apropos Flausen im Kopf. Dupa, Erzähler und Zeichner der Episoden um Cubitus, kann es sich nicht nehmen lassen und absolviert kleine Gastauftritte. Der Schöpfer tritt seinen Geschöpfen gegenüber. Rein äußerlich bringt sich Dupa in Form eines kleinen Bruders von Percy Pickwick zu Papier. Mit großem Schnäuzer und dunkler Brille ist er denn eher Spielball als Darsteller – Dupa hat seine eigenen Geschöpfe nicht im Griff. Und das ist gut so, möchte man als Leser wieder einmal rufen, denn die Art der kleinen Episoden in diesem Band ist sehr unterschiedlich und damit abwechslungsreich geraten.
Manchmal sind es kleine Beschreibungen – wie im Falle der Lexikaeinträge – mal wird eine Handlung von Hinweisen untermalt, die von Dupa höchstpersönlich stammen. – Ja, ich weiß, alle Hinweise stammen von Dupa, aber macht er eben selber … Ach, Ihr wisst schon. Insgesamt lässt es sich streiten, was hier nun besonders lustig ist oder welche Pointe besonders sitzt. Lustig bis urkomisch ist alles. Persönlich gefallen mir Cubitus‘ Ausreißer in andere Welten oder auch Rollen am besten. Wenn er als Sportler bei den Olympischen Spielen vertreten ist, erwachen kleine Erinnerungen an einen anderen berühmten Hund (sagt mir nicht, Goofy ist kein Hund), der seinen Sportsgeist übte.
Optisch lässt Dupa seine Figuren gerne wie auf einer Bühne agieren. Hin und wieder gewinnt man als Leser auch den Eindruck eines Boulevardstücks. Es fehlt nur noch ein begrenzender Vorhang. Sobald die Steuerbeamten die Szenerie betreten, sollte jedem Leser klar sein, wie dieser Eindruck entsteht. Dupas Version der grauen Herren, die von Boje Hundesteuer eintreiben wollen, ist garstig und kleingeistig, eigentlich so, wie sich jeder so gerne einen Steuerbeamten vorstellt. Außerdem legen ihre gebogenen Geiernasen nahe, Dupa habe sie mit den berühmt berüchtigten Aasgeiern in Verbindung bringen wollen.
Die Devise: Niemals aufgeben, auch wenn’s weh tut. Cubitus ist ein Stehaufmännchen. Was muss er nicht alles in sehr halsbrecherischer Manier durchleben. Klar, er teilt auch aus (arme Katze Paustian), aber nicht gerade selten geht es ihm selbst an den Kragen. Das ist von Dupa wunderbar leicht und klassisch cartoon gezeichnet. Die Action steht ein wenig mehr im Vordergrund, kein Wunder, denn wenn es um Sport geht, muss auch ein Vielfraß und Langschläfer wie Cubitus aktiv werden.
Cubitus als Pferd, als Sportler, als Kommentator, als gemeiner Hund, als Naschkatze … Cubitus dreht hier so richtig auf, ist vielseitiger und lässt es mit seinen Wahren Flunkergeschichten so richtig krachen. Mehr davon! 🙂
Cubitus 18 – Wahre Flunkergeschichten: Bei Amazon bestellen
Samstag, 20. Dezember 2008
 So mancher Comic-Fan hat vielleicht schon einmal davon geträumt: er schlendert über eine Comic-Con, begegnet dem Verleger seines Vertrauens und präsentiert eine vollkommen neue Idee oder auch eine zu einer bestehenden Serie. Die Idee wird genommen, gedruckt und wird ein Riesenerfolg … So wie die Simpsons vielleicht. Das gibt es natürlich nur im Traum. Oder im Comic. Im Bart Simpson-Comic. Bart hat so eine tolle Idee zu Radioactive Man. Er hofft, der Comic-Typ werde ihn den verantwortlichen Redakteuren vorstellen. Falsch gedacht.
So mancher Comic-Fan hat vielleicht schon einmal davon geträumt: er schlendert über eine Comic-Con, begegnet dem Verleger seines Vertrauens und präsentiert eine vollkommen neue Idee oder auch eine zu einer bestehenden Serie. Die Idee wird genommen, gedruckt und wird ein Riesenerfolg … So wie die Simpsons vielleicht. Das gibt es natürlich nur im Traum. Oder im Comic. Im Bart Simpson-Comic. Bart hat so eine tolle Idee zu Radioactive Man. Er hofft, der Comic-Typ werde ihn den verantwortlichen Redakteuren vorstellen. Falsch gedacht.
Doch wie es der Zufall will – war ja klar – gerät das Manuskript in die Hände der Redakteure, die sogleich außer sich sind und eine Wiedergeburt des Genres vor Augen haben. Unfassbar, nicht wahr? Aber es kommt noch besser …
Diese Odysee durch das Haifischbecken des Comic-Geschäfts soll hier nicht weiter gelüftet werden. Jedenfalls muss selbst der hochnäsige Comic-Typ feststellen, dass Barts Manuskript perfekt ist, in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Bart lernt die Härten der Prominenz kennen. Plötzlich ist er nicht mehr Bart Simpson, sondern B.S.. Der einzige Fehler der Geschichte namens Zugetextet ist ihre Kürze. Dafür werden die Fans nicht lange auf die Folter gespannt. Schnell geht es in die nächste Genre-Persiflage – eigentlich sind die Simpsons eine komplette Persiflage, oder? Man weiß es nicht genau.
Jedenfalls sehen wir Bart bald in der Angriff der 20-Meter-Maggie. Unfassbar, oder? Aber es ist ein ziemlicher Brüller, wenn Groß-Maggie im Stile der Fortsetzung von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf die Menschheit, Verzeihung, die Gelblinge von Springfield losgelassen wird.
Rein optisch sind die Bilder der ersten Geschichte von James Lloyd von Steve Steere Jr. sehr zerbrechlich getuscht und wirken viel echter als in neueren Produktionen, in denen die Linien mit einem Vektor-Programm gezogen worden zu sein scheinen. Ob nun sehr regelmäßig oder ein wenig neben der Spur wie auch in der folgenden Geschichte um die kleine Maggie, dem Humor tut das keinen Abbruch. Man muss sich wirklich fragen, was trashiger ist, Maggies Angriff auf riesigen Stummelbeinchen oder der wirkliche Angriff der 20-Meter-Frau aus den 50er Jahren.
Ein locker schnelles Vergnügen, in der die Simpsons-Kinder die Hauptrollen spielen und auch mal sehr gut ohne die Eltern auskommen. Wer es als Fan also ertragen kann, wenn Homer von Sicherheitspersonal abgewimmelt wird und ansonsten gar nichts zu vermelden hat, kann hier einen schönen humoristischen Bauchplatscher machen. 🙂
Montag, 01. Dezember 2008
 Eigentlich führen Damian und Alexander ein recht gutes Leben. Damian ist der etwas ausgeflipptere, chaotischere der beiden, während Alexander manchmal etwas peinlich berührt ist, wenn Damian neuerlich seine (schlechten) Sangeskünste unter Beweis stellt. Eines Tages verändert ein Gang zum Briefkasten ihr Leben. Damian hat eine Nachricht von seinem verschollenen Großonkel erhalten. Dieser Großonkel sollte mit einem Schiff untergegangen sein, doch Tagebuchaufzeichnungen, die nach dem Untergang vorgenommen wurden, widerlegen dies.
Eigentlich führen Damian und Alexander ein recht gutes Leben. Damian ist der etwas ausgeflipptere, chaotischere der beiden, während Alexander manchmal etwas peinlich berührt ist, wenn Damian neuerlich seine (schlechten) Sangeskünste unter Beweis stellt. Eines Tages verändert ein Gang zum Briefkasten ihr Leben. Damian hat eine Nachricht von seinem verschollenen Großonkel erhalten. Dieser Großonkel sollte mit einem Schiff untergegangen sein, doch Tagebuchaufzeichnungen, die nach dem Untergang vorgenommen wurden, widerlegen dies.
Im Besitz des Großonkels befand sich eine Jadestatuette eines Jaguars. Diese soll nun geborgen werden. Die Figur, aus dem ehemaligen Besitz des Schwarzmagiers Motzcatl, könnte sich in der Kabine des Großonkels an Bord des gesunkenen Passagierschiffs Victoria Luise befinden. Wo das Wrack liegt, ist bekannt. Eine Expedition wird ausgerüstet. Als letzter Nachkomme des Großonkels Johann Lind ist Damian nebst Freund dazu eingeladen, an der Tauchmission teilzunehmen.
Können Schwule auch Abenteuer erleben? (Vorsicht: Provokante Frage.) Spätestens seit den vielen Geschichten von Ralf König weiß der Leser, sie können genauso viel wie andere, wenn nicht mehr und das ist gut so. So machen sich Damian & Alexander auf zu einem großen Abenteuer, erotische Verwicklungen inklusive.
Thilo Krapp hat ein schwules Pärchen geschaffen, das gemäß aller abenteuerlichen Regeln, die sich heutzutage in diversen Geschichten finden, eine Berg- und Talfahrt von Anfang bis Ende mitmacht. Das Thema schwul wäre kaum weiter erwähnenswert, würde die Geschichte selbst nicht derart mit dem Thema kokettieren und eine Besonderheit daraus machen.
Eine Seefahrt ist hier nicht nur lustig, sondern macht deutlich, warum Frauen in der Seefahrt so lange ein solch schlechtes Ansehen hatten und als Unglücksbringer galten: Matrosen brauchten einfach keine Frauen. Klingt hart, doch dieser Eindruck stellt sich ein, wenn man sich manche etwas kindlich naiv erzählte Szene betrachtet. – Derlei Szenen tauchen in so gut wie jeder Liebesschnulze im Fernsehen auf, dann jedoch eher hetero- als homoorientiert. Ganz gleich, welche sexuelle Orientierung in der Erzählung vorherrscht, es sind meist bekannte Szenerien.
Komisch sind so manche Augenblicke in der Geschichte, in der Krapp seine Figuren los lässt und sie sich eher eigenständig verhalten. Krapp etabliert mit dem kleinen schüchternen Matrosen einen Running Gag. Der Matrose, fast noch ein Schiffsjunge, platzt immer im ungeeigneten Moment hinein, so lange, bis Krapp dieses Spiel auflöst und diese Momente nicht mehr heiß, sondern extrem frostig sind.
Komisch sind auch die verdutzt aufgerissenen großen Augen der beiden Hauptfiguren, die es teilweise kaum glauben können, dass sie angebaggert werden – besonders Alexander, dessen Schwarm sich plötzlich für ihn interessiert.
Abenteuerlich im besten Sinne eines Indiana Jones-Abenteuers wird es, sobald der grüne Jaguar ins Spiel kommt. Dieses Kleinod ist nicht nur alt und selten, sondern es besitzt in der Tat magische Fähigkeiten, mit denen sich Damian in höchster Lebensgefahr auseinandersetzen muss.
Die Tauchgänge lassen Bilder alter Abenteuerfilme wie Die Tiefe vor dem geistigen Auge auferstehen. Hier ist es jedoch bunter, nicht so düster und deshalb weniger bedrohlich.
Kindlich naiv erzählt bedeutet hier nicht zwangsläufig unsympathisch. Ganz im Gegenteil kann der Leser die beiden Helden Damian und Alexander immer mehr mögen lernen. Denn sie erinnern fast an eine schwule Variante von Peter und Alexander – nur der Papagei fehlt. So ist auch die grafische Umsetzung locker leicht, eher einfach zu nennen, cartoony eben. Krapp beherrscht den Umgang mit Details, wie es sich in diversen Szenen und Bildern zeigt, aber er arbeitet lieber großflächig und raumgreifend. Er bricht oft und gerne aus dem Satzspiegel aus, zuweilen wirkt es, als wolle er mit den Bildern regelrecht aus dem Blatt explodieren. Die Zeichnungen mögen einfach wirken, in ihrer Komposition zueinander – anders lässt es sich nicht beschreiben – strahlen sie Kraft aus.
Eine spaßige Geschichte, sehr unterhaltsam, schnell und kurzweilig erzählt. Wer abseits von Ralf König Geschichten mit schwulen und sehr sympathischen Helden sucht, sollte einen Blick riskieren.
Damian & Alexander 1 – Der grüne Jaguar: Bei Amazon bestellen
Samstag, 29. November 2008
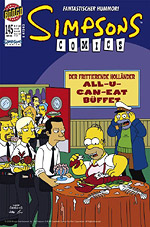 Homer hat das Problem vieler amerikanischer Hobby-Griller: Er hat keine Ahnung davon. Spätestens wenn Homer Grillanzünder auf einen Gasgrill schüttet, sollte jedem Betrachter klar sein, dass Amerika in Not ist. Oder dass Opa Feuer fängt. Oder die Simpsons hungrig bleiben. Wie gut, dass es den Frittierenden Holländer gibt! Hier warten Thunfisch-Rollen, gebackene Walschwanzflosse und natürlich der Fang des Tages. Leider befördert der Fang an diesem Tag eine Leiche mit Zementschuhen an die Oberfläche. Nach diesem auf Mafia-Art gemordeten Mann ist logisch, was der Fang des Tages auf der Karte ist: Italienisch gefüllte Krabben.
Homer hat das Problem vieler amerikanischer Hobby-Griller: Er hat keine Ahnung davon. Spätestens wenn Homer Grillanzünder auf einen Gasgrill schüttet, sollte jedem Betrachter klar sein, dass Amerika in Not ist. Oder dass Opa Feuer fängt. Oder die Simpsons hungrig bleiben. Wie gut, dass es den Frittierenden Holländer gibt! Hier warten Thunfisch-Rollen, gebackene Walschwanzflosse und natürlich der Fang des Tages. Leider befördert der Fang an diesem Tag eine Leiche mit Zementschuhen an die Oberfläche. Nach diesem auf Mafia-Art gemordeten Mann ist logisch, was der Fang des Tages auf der Karte ist: Italienisch gefüllte Krabben.
So weit, so makaber. Captain Horatio McCallister hat es aus den Weiten des Meeres an den Hafen verschlagen, wo er sein kleines Restaurant betreibt. Und wie so oft bei weit gereisten Personen gibt es auch bei ihm einen kleinen dunklen Fleck auf seiner Weste, der ihn nun einzuholen droht. Kaum sitzen die Simpsons bei ihm zu Tisch – wie ein böses Omen möchte man meinen – läuft ein Seelenverkäufer namens Lisa Marie im Hafen ein.
McCallisters alter Bootsmann Chowder Jackson ist zurück. Sein Herz ist voll von Rache. Sein Ziel ist es, seinen alten Skipper zu ruinieren.
Friss-Bis-Du-Platzt-Büffett – so oder ähnlich muss Homers Name für das Paradies sein. Oder für die Hölle. Einerlei, Homer scheint endlich seine Berufung gefunden zu haben. Der Leser errät es – das ist keine Kunst: Homer in der Nähe von Nahrungsmitteln, das kann nicht lange gut gehen. Homer, der ein Geschäft retten soll: Das kann erst recht nicht gut gehen. Aber Homer und seine Familie spielen hier eher die Nebenrolle. Das Raubein McCallister, ein verhinderter Seewolf – ebenso mies, aber irgendwie hysterisch – muss sich mit den Geistern seiner Vergangenheit auseinandersetzen – die ebenso mies und nicht weniger hysterisch sind.
Chuck Dixon entführt den Simpsons-Fan hier in die endlosen Weiten der Gastronomie, in die Konkurrenzkämpfe, die Feinschmeckerrestaurants, hin zu den Tricks der Gourmetköche … Machen wir uns nichts vor. Das perfekte Dinner sieht anders aus. Bereits zu Beginn veranstaltet Homer in bester Al Bundy– (immer die Asche vom letzten Jahr) und Doug Heffernan-Tradition (der brennt ein eigenes Logo ins Fleisch) ein Barbecue. Unter der Überschrift Koch der Karibik verbrennt Homer nicht nur sein Fleisch, sondern zündet eine mittlere Bombe in der Nachbarschaft. Dixon hätte sich genauso gut mit dem Kauf eines neuen Grills – oder einer kosmetischen Operation von Marge – beschäftigen können, aber er schickte seine Helden auf ein Hausboot, um Fisch zu essen.
Kapitän McCallister, der ein wenig an eine amerikanische Cartoon-Variante unseres allseits beliebten Karl Dall erinnert und dessen ARR vor jedem zweiten Satz sehr gut von dem Komödianten und Moderator interpretiert werden könnte, erzählt ein Seemannsgarn, mit dem er sich nicht hinter Größen wie Käpt’n Blaubär zu verstecken braucht. Allein die Hamster, die sich hier wie wild gewordene Tribbles verhalten, sind für die Geschichte Gold wert.
Die Zeichnungen – kommen wir zum gewohnten Teil – sind so gut wie immer. Keine Ausrutscher sind in der Ausführung erkennbar. Phil Ortiz liefert eine prima Arbeit im Rahmen der Vorgaben ab, die von Mike Decarlo (Tusche) und Art Villanueva (Farben) perfekt fortgeführt werden.
Wer sich für Figuren abseits der Simpsons-Familie interessiert, kann diesmal dem Schicksal von Kapitä McCallister folgen, der sich in einer gastronomischen Schlacht ohnegleichen bewähren muss. Aber was ein echter Seebär ist … 🙂
Freitag, 28. November 2008
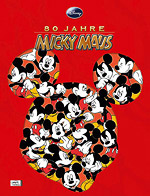 Micky Maus hat keinen Beruf. Alle anderen aus seinem Freundeskreis haben einen, nur Micky nicht. Er lebt in den Tag hinein, ein Zustand, der Minnie Angst macht, denn Micky ist ein Abenteurer. Und Abenteuer gibt es immer wieder. Wozu also arbeiten? Doch Frauen vermögen es, sich durchzusetzen. Minnie macht da keine Ausnahme. Also tut Micky Maus, was eine Maus eben tun muss: Er meldet sich zu den Postfliegern. Angeblich gibt es keinen harmloseren Beruf … Angeblich. Jedenfalls wenn man’s kann.
Micky Maus hat keinen Beruf. Alle anderen aus seinem Freundeskreis haben einen, nur Micky nicht. Er lebt in den Tag hinein, ein Zustand, der Minnie Angst macht, denn Micky ist ein Abenteurer. Und Abenteuer gibt es immer wieder. Wozu also arbeiten? Doch Frauen vermögen es, sich durchzusetzen. Minnie macht da keine Ausnahme. Also tut Micky Maus, was eine Maus eben tun muss: Er meldet sich zu den Postfliegern. Angeblich gibt es keinen harmloseren Beruf … Angeblich. Jedenfalls wenn man’s kann.
In den frühen Jahren, genauer 1933, war Micky Maus noch ein kleiner bis mittelgroßer Chaot, der das vorwegnahm, was ein Donald Duck später in Serie produzierte. Aber selbstverständlich war er bereits in seinen frühen Jahren ebenso liebenswert, wie er es heute noch ist. Bereits nachdem Micky dem Netz der Luftpiraten entkommen ist, macht er sich auf die Suche nach dem Juwel von Mono Tono. Der Leser befindet sich nun im Jahr 1961 und Goofy befindet sich natürlich an seiner Seite. Die Maus ist bereits sehr bedächtiger. Für das Chaos oder besser für den kleinen Tritt in den Fettnapf sorgt Goofy. Paul Murry zeichnet hier die berühmte Handhaltung Goofys (Handspitze zum Mund gerichtet, Handfläche nach unten), die zu sehen ist, wenn der gute Kerl mal wieder nach Fassung ringt.
Es wird gesagt, dass Paul Murry das Bild von Micky Maus als Meisterdetektiv prägte und wahrhaftig brachten die 60er und hierzulande die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts tolle Abenteuer für die jugendlichen Leser, die sich am Magazin selbst wie auch an Ausgaben wie Mickyvision erfreuen durften. Jugendliche Leser von damals und Micky Maus-Fans dürften diese Strichtechnik in guter Erinnerung behalten haben. Nach den zerbrechlichen Zeichnungen von Floyd Gottfredson, einer der Legenden aus dem Hause Disney, wirken die Bilder von Murry viel kräftiger, ernsthafter und geschlossener.
Die Sprünge, anders ist es auch angesichts einer 80jährigen Lebensgeschichte nicht machbar, landen nach einer Episode aus den 70er Jahren schnell in der relativen Gegenwart. Der doppelte Goofy schickt das Ermittlungsduo Micky und Goofy wieder in einen brandgefährlichen Fall. Plötzlich gibt es zwei dieser tollpatschigen Freunde. Goofy löst den Fall durch seine unnachahmliche Logik: Und wie der Kerl aus der Tür rausschießt, weiß ich, wer’s ist, weil ich ja weiß, ich bin ich, also kann er nicht ich sein. Dank des Zeichners Giorgio Cavazzano bleibt der grafische Stil von Paul Murry noch erhalten. Die Bilder haben zweifelsohne eine eigene Handschrift, können eine Anlehnung an den Altmeister aber nicht verleugnen.
Wie man einen fliegenden Fisch fängt beantwortet die gleichnamige Geschichte von 1996, die hier in einer deutschen Erstveröffentlichung vorliegt, wie insgesamt zwei der sieben Geschichten. Paco Rodrigues’ Bilder sind schon eine Spur moderner. Ihnen haftet nicht mehr der traditionelle Strich der Disney-Produktionen an, wie er noch in den klassischen Zeichentrickproduktionen wie Dornröschen oder Pinocchio zu sehen ist. Rodrigues bringt uns hier noch einmal Kater Karlo und einen kriminellen Kumpanen näher. Letzterer trägt den typischen disneyesken Kinnbart, der von jeher an einen Besen erinnerte. Solche und andere Details halten die Nostalgiefahne hoch.
Im neuen Jahrtausend angekommen ist alles etwas glatter geworden. Das hindert jedoch nicht daran, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Wo kommt Pluto eigentlich her? Plutos Geheimnis wird endlich gelüftet. Nachdem verschiedene Versionen darüber erzählt wurden, wie Pluto zu Micky kam, kommt auch Pluto selbst zu Wort, wenn man es so nennen kann. Nostalgisch geht es auch mit der Umsetzung der Figur Micky Maus selbst weiter. Die rote kurze Hose mit den beiden gelben Knöpfen ist zurück. Manchmal muss eine Maus eben nicht nur tun, was eine Maus tun muss, manchmal ist Mode einfach zeitlos und sinnvoll. Und obwohl sich der Mäuserich vielfach in unterschiedlichen Kleidungen und Kostümierungen bewährte, ist diese rote Hose ein ebensolches Markenzeichen wie seine (annähernd) runden Ohren.
Ein schöner Rückblick, ein kleiner Ausblick auf eine Figur, die, obwohl erfunden, nun schon auf ein ganzes Menschenalter zurückschauen kann. Der Querschnitt mag vielleicht helfen, kleine Leser an Micky heranzuführen, wenn sie die Figur nicht sowieso schon für sich entdeckt haben – vielmehr wenn ihre Eltern es nicht schon als Tradition erachteten mit Micky aufzuwachsen. 🙂
80 Jahre Micky Maus: Bei Amazon bestellen
Donnerstag, 13. November 2008
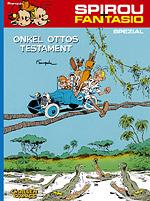 Die Nachricht ist traurig, aber was will man machen, das ist nun einmal der Lauf der Welt: Onkel Otto ist tot. Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Spirou erfährt von einem Onkel, den er nie kennen gelernt hat und der ist gerade eben verstorben. Natürlich nicht, ohne ein Erbe zu hinterlassen und so müssen Spirou und sein Freund Fantasio in einen entlegenen Winkel von Afrika, um diese Hinterlassenschaft zu finden.
Die Nachricht ist traurig, aber was will man machen, das ist nun einmal der Lauf der Welt: Onkel Otto ist tot. Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Spirou erfährt von einem Onkel, den er nie kennen gelernt hat und der ist gerade eben verstorben. Natürlich nicht, ohne ein Erbe zu hinterlassen und so müssen Spirou und sein Freund Fantasio in einen entlegenen Winkel von Afrika, um diese Hinterlassenschaft zu finden.
Halt! Ganz so einfach haben es die beiden doch nicht! Bereits in ihren frühen Tagen, als die Beine noch aus dehnbarem Gummi und die Hälse außergewöhnlich lang waren, hat André Franquin seinen Helden schon das Leben besonders schwer gemacht.
Im ehemaligen Haus des Onkels angekommen, der Eulenburg, wartet eine Überraschung auf sie. Jemand anderes durchforstet bereits die Räume nach Hinweisen auf ein weitaus größeres Erbe, als es das heruntergekommene Gemäuer zu bieten hat. Sofort kommt es mit dem Eindringling zum Kampf und der letzte Hinweis ist ausgelegt.
Die Geschichten, die hier in Onkel Ottos Testament erzählt werden, sind aus heutiger Sicht von politisch korrekter Erzählweise weit entfernt. Wenn sich Afrikaner über die gruseligen Darstellungen ihrer Landsleute in Tim im Kongo beschweren, könnten sie hier auch beinahe dazu verleitet werden – allerdings ist Franquin bei näherer Betrachtung überaus herzlich am Werke. Selbst wenn ein einbeiniger Gauner an die Wand geworfen und sein Buckel als Versteck für wichtige Papiere entlarvt wird.
Eine der Schlüsselszenen, die diese Herzlichkeit deutlich machen, zeigt die Bewachung des Verstecks von Onkel Ottos Erbe. Ein Wasserhindernis wird von Krokodilen beherrscht, ein angeketteter Löwe steht vor dem ersten Eingang. Vor dem zweiten Durchgang steht die Frau des Medizinmannes. Der Mann schickt seine Frau nicht sehr forsch nach Hause, wirkt sie doch auch arg bedrohlich auf ihren eigenen Mann.
Diese Geschichte war Franquins allererster Comic …
Das sieht man!
Aber ob ihr’s glaubt oder nicht: Man hat ihn trotzdem gebeten, weiterzumachen!
Gaston leitet von der ersten kleinen Episode Der Panzer zum verblichenen Onkel Otto über. Die Zeichnungen mögen aus heutiger Sicht sehr merkwürdig wirken und von dem, was der Leser von einem späteren Franquin gewohnt ist, ist er hier noch weit entfernt. Aber der Humor ist hier schon erkennbar. Das Talent zum Slapstick ist klar erkennbar, vielleicht sogar etwas zu überdreht: Fantasio am Steuer eines Panzers. Daraus kann nur Kleinholz werden. Aus allem anderen jedenfalls, nur nicht aus dem Panzer.
Die Zeichnungen kennt der Leser in dieser oder jener aus jenen alten Tagen der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ein Disney-Studio brachte seine Figuren so und auch ein Franquin hatte noch nicht den eigenen Stil, der ihn markant von anderen abhob. Es waren Gummimännchen, die in diesen Zeiten den Comic und den Trickfilm beherrschten. Besonders von letzterem zeugt so manche Bewegung, die geradewegs aus einem Lehrbuch der Animation im zweidimensionalen Raum herrühren mag. Jede Regung, körperlich oder gefühlsmäßig, ist übertrieben.
In der zweiten Episode, der namensgebenden, findet eine Entwicklung statt. Zu Beginn mag der Leser noch altbackenen Vorgaben wieder erkennen. Aber Franquin gönnt sich den Mut zur Gestaltung eigener Gesichter, Karikaturen fast. Er experimentiert mit Tieren und wirft sie in die humoristische Schlacht. Ein Gorilla wird zum Butler, Raubkatzen schlagen sich um einen schmackhaften Spirou, der von alldem nichts bemerkt. Trotzdem ist es von dort zu den bekannten Franquin-Bildern ein weiter Weg. Es hat sich gezeigt, dass viele Zeichner noch eine deutliche Entwicklung durchmachen. Wer alleine in diesem Band die alten Zeichnungen mit dem einige Worte sagenden Gaston vergleicht, entdeckt einen Unterschied von Tag und Nacht – bildlich gesprochen.
Ein paar uralte und beinahe verschollen geglaubte Mini-Episoden runden die vorliegende nostalgische Comic-Reise ab.
Ein Band für den absoluten Spirou + Fantasio Fan, der einen Blick in längst vergangene Zeiten werfen mag, als die Comics noch sehr jung waren, ein Talent wie André Franquin noch am Anfang stand und ein künstlerischer Rohdiamant war. 🙂
Spirou + Fantasio – Onkel Ottos Testament: Bei Amazon bestellen
Mittwoch, 12. November 2008
 Kleine oder besser kleinere Menschen entwickeln zuweilen einen ganz besonderen Biss, einen starken Ehrgeiz oder großes Durchsetzungsvermögen. Aber was ist, wenn diese Menschen sehr klein sind? So klein, dass sie auf einer Handfläche Platz finden? Was ist, wenn diese Menschen so zahlreich sind, dass sie eine eigene Kolonie gründen können? Nein, dann handelt es sich nicht um Schlümpfe, sondern um die Minimenschen, die im Reiche des Cartoons bereits seit 40 Jahren eine Heimat haben und mit ihren Abenteuern aus der Sicht der Winzlinge immer wieder neu überrascht und begeistert haben.
Kleine oder besser kleinere Menschen entwickeln zuweilen einen ganz besonderen Biss, einen starken Ehrgeiz oder großes Durchsetzungsvermögen. Aber was ist, wenn diese Menschen sehr klein sind? So klein, dass sie auf einer Handfläche Platz finden? Was ist, wenn diese Menschen so zahlreich sind, dass sie eine eigene Kolonie gründen können? Nein, dann handelt es sich nicht um Schlümpfe, sondern um die Minimenschen, die im Reiche des Cartoons bereits seit 40 Jahren eine Heimat haben und mit ihren Abenteuern aus der Sicht der Winzlinge immer wieder neu überrascht und begeistert haben.
Zum Auftakt sieht der Leser einen Kampfjet, der vor einem blauen Himmel über eine Wiese rast, auf der ein Traktor geparkt ist. Die Umgebung macht schon deutlich, dass es sich um eine gemütlich ländliche Atmosphäre handelt und plötzlich … jagt der Jet vor den Abgasrohren des Traktors daher, die nun wie ein Paar riesige Säulen emporragen. Ein Busch kurz darauf hat gar die Ausmaße eines ausgewachsenen Wäldchens. Als sich nur ein Bild später eine Landebahn aus einer Grasfläche zu entfalten beginnt, begreift der Leser, dass das Szenario sich hart an der Realität befindet und dennoch stimmt etwas nicht. Die Größenverhältnisse!
Pierre Seron, Autor und Zeichner dieser Serie um eine der kuriosesten Siedlungen in der Comic-Geschichte, schmeißt den Leser ohne große Vorankündigung ins kalte Wasser. Er beginnt mit dem berühmten Knall am Anfang einer Geschichte, dem Rätsel, dem Unerwarteten und kreiert so ein Paradebeispiel für eine der Gesetzmäßigkeiten einer fesselnden Handlung. Knall auf Fall entdeckt der Leser nun eine miniaturisierte Welt, die den Anschein des Normalen hat und trotzdem ein Dasein im Verborgenen führt.
Wie ist das passiert? Wie nur?
Diese Fragen stellt Seron selber, nachdem er den Leser gepackt hat. Ein unförmiger, aber ansonsten unscheinbarer Stein ist für die veränderten Verhältnisse verantwortlich. Der Professor, der den Stein fand und an ihm forschte, war das erste Miniopfer, das auf Puppengröße schrumpfte. Nach und nach, durch Körperkontakt jeglicher Art ins Rollen gebracht, schrumpft die gesamte Gemeinde. Auch Tiere bleiben nicht verschont. Die Menschen arrangieren sich mit der neuen Situation und verschwinden für den Rest der Welt. Doch als Minimensch in der Welt der Großen zu leben ist alles andere als leicht, denn für die Gemeinde beginnt ihr neue Zivilisation bei Null.
Die Gefahr der Entdeckung ist das allgegenwärtige Spielelement. Auch sind Menschen von der Größe einer Hand natürlich in allem benachteiligt, was das Umfeld der Großen betrifft. So müssen sich die Minimenschen damit auseinandersetzen, den Ausbau eines militärischen Geländes zu sabotieren. Dank modernster Technik – in der Form, wie man sich gemeinhin moderne oder auch futuristische Technik in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts vorstellte – schaffen sie immer den halsbrecherischen Spagat des gerade anstehenden Auftrags. So verschlägt es sie hierbei an die Spitze eines Kirchturms, in die ländliche Idylle und auch in die Praxis eines Psychiaters.
Pierre Seron lässt seiner Phantasie absolut freien Lauf und so ist einfach alles möglich. Diese Ideen ohne Grenzen machen die Minimenschen zu einer Besonderheit. Dies mag auch der Grund für den zeitlosen Humor sein – seltsamerweise sind die futuristischen Fahrzeuge immer noch futuristisch, wirken nur nicht mehr so hipp.
Grafisch sind die Bilder von Seron äußerst frankobelgisch klassisch. Die Minimenschen reihen sich optisch ein in Publikationen wie Boule & Bill, Gaston oder Spirou + Fantasio. Nicht nur die Gesichter, sondern auch die Gesichtsausdrücke – ganz besonders die cholerisch rot angelaufenen wie auch die verdutzten – sind typische Franzosengesichter, möchte man als anderssprachiger Leser fast sagen, wenn einem Komödianten wie Pierre Richard oder Louis de Funès vor dem inneren Auge herumspuken.
Ein zeitloser Spaß, in dem allein die Beschaffung von Zucker bereits zu einem großen Abenteuer wird. Seron hat einen Klassiker der Komödie allgemein geschaffen, der immer noch Vorbildcharakter hat. Für alle Altersgruppen geeignet. 🙂
Die Maxiausgabe der Minimenschen 1: Bei Amazon bestellen
Samstag, 25. Oktober 2008
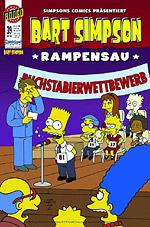 Endlich ist der Tag gekommen: Zombie Summer Camp III. Der Film ist in den Kinos. Das muss einfach der beste Film aller Zeiten sein. So hofft es jedenfalls Bart. Voller Elan macht er sich auf den Weg … aber niemand von den Erwachsenen will mitkommen und ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten darf jemand in Barts Alter die Gemetzel auf der Leinwand nicht sehen. Was tun? Wäre es nicht viel schöner, erwachsen zu sein und alles tun und lassen zu können, was man so will? Bart hat einen Wunsch: Ich wünschte, ich wäre alt genug, meine eigenen Regel aufzustellen. Als seine Mutter den jungen Mann, der einzig mit einer Unterhose bekleidet in Barts Baumhaus liegt, aus demselben vertreibt, merkt Bart schnell, dass es etwas faul ist in Springfield.
Endlich ist der Tag gekommen: Zombie Summer Camp III. Der Film ist in den Kinos. Das muss einfach der beste Film aller Zeiten sein. So hofft es jedenfalls Bart. Voller Elan macht er sich auf den Weg … aber niemand von den Erwachsenen will mitkommen und ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten darf jemand in Barts Alter die Gemetzel auf der Leinwand nicht sehen. Was tun? Wäre es nicht viel schöner, erwachsen zu sein und alles tun und lassen zu können, was man so will? Bart hat einen Wunsch: Ich wünschte, ich wäre alt genug, meine eigenen Regel aufzustellen. Als seine Mutter den jungen Mann, der einzig mit einer Unterhose bekleidet in Barts Baumhaus liegt, aus demselben vertreibt, merkt Bart schnell, dass es etwas faul ist in Springfield.
Aber das ist nichts Neues in dieser kleinen merkwürdigen Stadt, die auf ihre Art der Nabel der Welt ist. Plötzlich ist es in Springfield illegal, kein Geld zu haben. Dieses gesetzliche Hilfsmittel, das eigentlich dazu dienen sollte mit zombiefizierten Billionärs-Bettlern fertig zu werden, wird zum Zankapfel, als Maggie Simpson, ihres Zeichens noch ein Baby, wegen ihres mangelnden Besitzes angeklagt werden soll.
Die sind ja verrückt, die in Springfield! Aber seien wir ehrlich, das wussten wir doch schon. Aber so verrückt? Ein Baby anzuklagen, hat eine völlig neue Dimension, selbst für Comic-Verhältnisse. Nun gut, in dem von Bart so beliebten Splatter-Genre wurden auch schon Babys vor Gericht angeklagt, aber Maggie kann kaum mit mordenden Monsterbabys in einen Topf geworfen werden … na, in einen Topf sowieso nicht. Obwohl auch das als Idee eines Simpson-Autoren denkbar wäre. Mehrere dieser Menschen mit wahnwitzigen Ideen haben sich hier versammelt.
Amanda McCann (irgendwie klingt ihr Name wie der einer Politikerin) entwirft einen erwachsenen Bart, der in eine ähnliche Situation kommt, wie es seinerzeit schon Tom Hanks in Big schaffte oder auch Jennifer Garner in 30 über Nacht. Bart muss arbeiten gehen. Und dieser Job hat es körperlich in sich.
Besser klappt es da schon in dem Einseiter von Patric Verrone. In Der unglaubliche Bart betört er die Besucher eines Altersheims mit seinen hypnotischen Fähigkeiten.
Und was macht jemand in den USA – na, hier auch – der angeklagt wird, fälschlich oder richtig, berühmt ist, einen Namen hat, irgendwie im Fernsehen und den Nachrichten ist, der … Was macht der? Richtig, der schreibt ein Buch. (Oder lässt schreiben, was wohl meistens der Fall sein dürfte.) So wird auch Maggie dank Tom Peyer zum Medienstar – und reich. Auf feine und sehr treffende Weise karikiert Peyer den Gesellschaftswahn um Meldungen und Nachrichten sowie die Möglichkeit in den USA jemanden zu verklagen. (Die Klage eines ehemaligen Senators gegen Gott scheiterte jüngst wegen Unzustellbarkeit der Klageschrift.)
Grafisch hält sich alles im gewohnt guten Rahmen. Bekannte Simpsons-Zeichner wie Phil Ortiz und John Costanza sind mit dabei. Einige großformatige, mitunter auch ganzseitige Bilder zeigen die Simpsons ungewohnt hervorgehoben, aber immer höchst exakt dank eines peniblen Tuschens.
Gute Kost für den schnellen Simpsons-Humorhunger, gut abgeschmeckt, sehr albern, spitzfindig, hintergründig, in jedem Fall ein Spaß. Simpsons eben. Was soll man mehr sagen? 🙂
Kommentare deaktiviert für Bart Simpson 39 – Rampensau
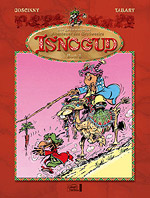 Möhren sorgen für gute Laune. Wer Möhren isst, verhält sich besser und ist netter zu seinen Mitmenschen. Isnogud, der Großwesir, sollte einmal Möhren essen. Aber wo bekommt man im Orient so etwas wie Möhren? Und wie sehen Möhren überhaupt aus? Harun al-Pussah, der Kalif von Bagdad, wagt sich auf die Suche nach diesem sagenhaften Gemüse. Oder ist es Obst? Die Gutmütigkeit und die Unwissenheit des Kalifen wird mitunter ausgenutzt, so in dem Fall, als ein Händler dem Kalifen Bananen anstelle von Möhren anbietet. Die Wirkung dieser Möhren ist allerdings gleich Null, weshalb der Schwindel schnell auffliegt.
Möhren sorgen für gute Laune. Wer Möhren isst, verhält sich besser und ist netter zu seinen Mitmenschen. Isnogud, der Großwesir, sollte einmal Möhren essen. Aber wo bekommt man im Orient so etwas wie Möhren? Und wie sehen Möhren überhaupt aus? Harun al-Pussah, der Kalif von Bagdad, wagt sich auf die Suche nach diesem sagenhaften Gemüse. Oder ist es Obst? Die Gutmütigkeit und die Unwissenheit des Kalifen wird mitunter ausgenutzt, so in dem Fall, als ein Händler dem Kalifen Bananen anstelle von Möhren anbietet. Die Wirkung dieser Möhren ist allerdings gleich Null, weshalb der Schwindel schnell auffliegt.
Isnogud gut? Bestimmt nicht. Mag sich der Kalif noch so sehr bemühen, sein Großwesir sinnt weiterhin auf den ganz großen Plan, um seinen unliebsamen Vorgesetzten endlich loszuwerden. In Bagdad selber hat Isnogud schon ziemlich viele Möglichkeiten ausgeschöpft. Neue Ideen ergeben sich hier selten. Da trifft es sich, dass eines Tages eine Landefähre aus dem All in der Wüste niedergeht, außerirdische Forscher dem Landemodul entsteigen und neugierig auf die unbekannte Umgebung schauen. Nachdem sie ergebnislos versucht haben, mit einem Kamel Kontakt aufzunehmen, entdeckt Isnogud etwas sehr interessantes bei ihnen: Eine Waffe, die denjenigen, der von ihrem Blitzstrahl getroffen wird, auflöst. – Und schon hat der Großwesir eine neue Idee, wie er den Kalifen loswerden kann.
Es ist eher die Ausnahme, dass Kalif Harun al-Pussah eine Episode ganz für sich alleine hat. Die Suche nach den Möhrchen für Isnogud ist von René Goscinny ganz besonders liebevoll und mit viel Herz geschrieben worden. Außerdem kann sich der Leser auf einen Gastauftritt einiger Kameraden freuen, die in den Gewässern des Orients ganz bestimmt keine ’öme’ und auch keine Gallier finden werden – so kommen sie wenigstens einmal relativ heil davon.
Nach einigen Abenteuern, in denen auch ein Plan mit einer Tse-Tse-Fliege misslingt, scheint endlich der große Tag gekommen zu sein: Der Narrentag. Endlich herrscht Rollentausch, die Kleinen können groß sein, die Großen lernen das untere Ende der Leiter kennen. Pantoffelhelden haben plötzlich das Sagen, Sklaven lassen sich bedienen und Großwesire? Es ist absolut herrlich, wie Isnogud seine eintägige Machtposition zu nutzen versucht, damit aus einem Tag als Herrscher viele werden.
Goscinny lässt seinen Helden auch nach diesem Debakel nicht aufgeben. Das muss man dem kleinen Mann als Leser lassen: Hartnäckig ist er. Alte Gesetze wie das der Herausforderung sind nur Anlass zu einem Zwischenspiel. Aufwändiger wird es, wenn Wahlen in Bagdad anstehen und plötzlich nicht mehr nur einer, der Kalif nämlich, zur Wahl steht, sondern viele. Plötzlich läuft in Bagdad alles kunterbunt durcheinander.
Goscinny ist ein Meister des kleinen feinen Humors wie auch des knallenden Wortwitzes und der Situationskomik. Derlei kann nicht zur Gänze gelernt werden, sondern es muss auch ein gewisses Grundtalent vorhanden sein, denn einen Menschen zum Lachen zu bringen, ist so leicht auch wieder nicht. Auch wird hier von Goscinny ein besonderes Werkzeug orientalischer Märchen aufgegriffen, das der Leser später in einer anderen Reihe neu entdecken wird – auch nicht ganz bezuglos zu Isnogud.
Asterix im Morgenland heißt dieses Abenteuer, in Indien angesiedelt, in dem der Bösewicht eine nicht unwesentliche Ähnlichkeit mit Isnogud besitzt. Nun sind die Teppiche in dieser besonderen Episode von Isnogud mit dem Titel Der Zauberteppich ganz besonders gestrickt … gewebt natürlich. Sie lassen einen Menschen verschwinden, indem sie ihn nach Peking transportieren und dann einfach nicht zurückfliegen. – Warum Goscinny ausgerechnet dieses Ziel für seinen Teppich wählte, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Die ausbleibende Verwunderung der Chinesen über die seltsamen Neuankömmlinge, die das Pech haben auf einem solchen Teppich zu sitzen, ist jedoch für mehrere Lacher gut. Es ist halt das Land des Lächelns.
Jean Tabary vertieft sich wieder in einen herrlich cholerischen Isnogud, der die ideale Rolle für Louis de Funès gewesen wäre. Wer den frankobelgischen Humor zu schätzen weiß, in einer glänzenden Farbenpracht übrigens, der wird mit einer guten Mixtur aus längeren und kürzeren Geschichten bestens unterhalten. 🙂
Isnogud – Buch 3: Bei Amazon bestellen
Kommentare deaktiviert für Isnogud – Buch 3
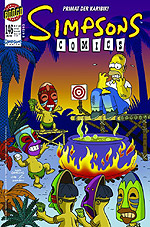 Eine Sportübertragung im Fernsehen – genauer ein Endspiel der Computerspieler – und eine Platte mit fettigem Essen, eine Flasche Bier, was will der Mensch, Verzeihung, der Homer mehr? Vielleicht ein neues verbessertes Bier? Als Homer die Reklame zum neuen verbesserten Duff im Fernsehen sieht, ist es jedenfalls gleich um ihn geschehen. Was könnte schöner sein als eine verbesserte Variante seines heiß und innig geliebten Getränks?
Eine Sportübertragung im Fernsehen – genauer ein Endspiel der Computerspieler – und eine Platte mit fettigem Essen, eine Flasche Bier, was will der Mensch, Verzeihung, der Homer mehr? Vielleicht ein neues verbessertes Bier? Als Homer die Reklame zum neuen verbesserten Duff im Fernsehen sieht, ist es jedenfalls gleich um ihn geschehen. Was könnte schöner sein als eine verbesserte Variante seines heiß und innig geliebten Getränks?









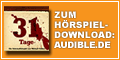

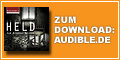
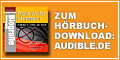



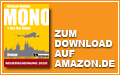
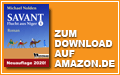
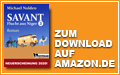
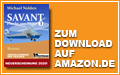

 So mancher Comic-Fan hat vielleicht schon einmal davon geträumt: er schlendert über eine Comic-Con, begegnet dem Verleger seines Vertrauens und präsentiert eine vollkommen neue Idee oder auch eine zu einer bestehenden Serie. Die Idee wird genommen, gedruckt und wird ein Riesenerfolg … So wie die Simpsons vielleicht. Das gibt es natürlich nur im Traum. Oder im Comic. Im Bart Simpson-Comic. Bart hat so eine tolle Idee zu Radioactive Man. Er hofft, der Comic-Typ werde ihn den verantwortlichen Redakteuren vorstellen. Falsch gedacht.
So mancher Comic-Fan hat vielleicht schon einmal davon geträumt: er schlendert über eine Comic-Con, begegnet dem Verleger seines Vertrauens und präsentiert eine vollkommen neue Idee oder auch eine zu einer bestehenden Serie. Die Idee wird genommen, gedruckt und wird ein Riesenerfolg … So wie die Simpsons vielleicht. Das gibt es natürlich nur im Traum. Oder im Comic. Im Bart Simpson-Comic. Bart hat so eine tolle Idee zu Radioactive Man. Er hofft, der Comic-Typ werde ihn den verantwortlichen Redakteuren vorstellen. Falsch gedacht.
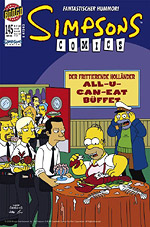 Homer hat das Problem vieler amerikanischer Hobby-Griller: Er hat keine Ahnung davon. Spätestens wenn Homer Grillanzünder auf einen Gasgrill schüttet, sollte jedem Betrachter klar sein, dass Amerika in Not ist. Oder dass Opa Feuer fängt. Oder die Simpsons hungrig bleiben. Wie gut, dass es den Frittierenden Holländer gibt! Hier warten Thunfisch-Rollen, gebackene Walschwanzflosse und natürlich der Fang des Tages. Leider befördert der Fang an diesem Tag eine Leiche mit Zementschuhen an die Oberfläche. Nach diesem auf Mafia-Art gemordeten Mann ist logisch, was der Fang des Tages auf der Karte ist: Italienisch gefüllte Krabben.
Homer hat das Problem vieler amerikanischer Hobby-Griller: Er hat keine Ahnung davon. Spätestens wenn Homer Grillanzünder auf einen Gasgrill schüttet, sollte jedem Betrachter klar sein, dass Amerika in Not ist. Oder dass Opa Feuer fängt. Oder die Simpsons hungrig bleiben. Wie gut, dass es den Frittierenden Holländer gibt! Hier warten Thunfisch-Rollen, gebackene Walschwanzflosse und natürlich der Fang des Tages. Leider befördert der Fang an diesem Tag eine Leiche mit Zementschuhen an die Oberfläche. Nach diesem auf Mafia-Art gemordeten Mann ist logisch, was der Fang des Tages auf der Karte ist: Italienisch gefüllte Krabben.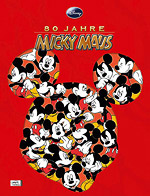
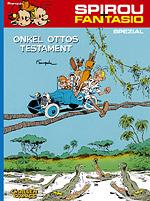

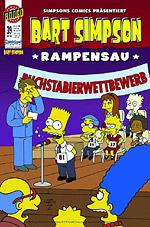 Endlich ist der Tag gekommen: Zombie Summer Camp III. Der Film ist in den Kinos. Das muss einfach der beste Film aller Zeiten sein. So hofft es jedenfalls Bart. Voller Elan macht er sich auf den Weg … aber niemand von den Erwachsenen will mitkommen und ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten darf jemand in Barts Alter die Gemetzel auf der Leinwand nicht sehen. Was tun? Wäre es nicht viel schöner, erwachsen zu sein und alles tun und lassen zu können, was man so will? Bart hat einen Wunsch: Ich wünschte, ich wäre alt genug, meine eigenen Regel aufzustellen. Als seine Mutter den jungen Mann, der einzig mit einer Unterhose bekleidet in Barts Baumhaus liegt, aus demselben vertreibt, merkt Bart schnell, dass es etwas faul ist in Springfield.
Endlich ist der Tag gekommen: Zombie Summer Camp III. Der Film ist in den Kinos. Das muss einfach der beste Film aller Zeiten sein. So hofft es jedenfalls Bart. Voller Elan macht er sich auf den Weg … aber niemand von den Erwachsenen will mitkommen und ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten darf jemand in Barts Alter die Gemetzel auf der Leinwand nicht sehen. Was tun? Wäre es nicht viel schöner, erwachsen zu sein und alles tun und lassen zu können, was man so will? Bart hat einen Wunsch: Ich wünschte, ich wäre alt genug, meine eigenen Regel aufzustellen. Als seine Mutter den jungen Mann, der einzig mit einer Unterhose bekleidet in Barts Baumhaus liegt, aus demselben vertreibt, merkt Bart schnell, dass es etwas faul ist in Springfield.